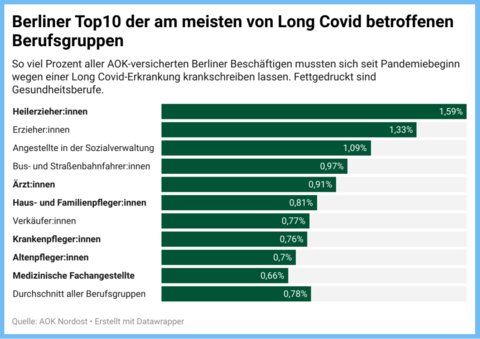Wochenbettdepressionen häufig nicht erkannt

Depressionen nach der Geburt des Kindes sind nicht selten – Foto: S.Kobold - Fotolia
Wochenbettdepressionen werden nach Meinung von Experten noch immer unterschätzt und häufig nicht richtig diagnostiziert. Dabei leiden etwa 10 bis 15 Prozent der Mütter unter Depressionen nach der Geburt, wie Dr. Silvia Oddo-Sommerfeld, Leitende Psychologin in der Abteilung für Geburtshilfe des Universitätsklinikums Frankfurt, betont. Die Erkrankung ist häufig auch deshalb schwer zu erkennen, weil die Frauen aus Scham- und Schuldgefühlen nicht über ihre Situation sprechen. Häufig schreiben sie sich ihre negativen Gefühle selber zu, glauben, sie hätten versagt und seien keine gute Mutter. Aber auch Ärzte und Psychiater erkennen die Ernsthaftigkeit der Erkrankung oft nicht, wie Professor Andreas Reif, Direktor der Abteilung für Psychiatrie an der Uniklinik Frankfurt, betont. Bei den Medizinern seien Ausbildung und Wissen beim Thema Wochenbettdepression oft nicht ausreichend.
Wochenbettdepression nicht mit Babyblues verwechseln
Häufig wird die Wochenbettdepression auch mit dem sogenannten „Babyblues“ verwechselt. Dieser tritt bei 50 bis 60 Prozent der Frauen auf. Der Blues ist jedoch von einer echten Wochenbettdepression zu unterscheiden. In der Regel sei er hormonell begründet, trete meist in der ersten Woche nach der Geburt auf und gehe schnell wieder vorbei, so Oddo-Sommerfeld. Daher müsse er normalerweise auch nicht behandelt werden. Bei der echten Wochenbettdepression sei dies anders. Sie kann von starker Erschöpfung, Niedergeschlagenheit und Ängsten bis hin zu Schuldgefühlen und sogar Suizidgedanken reichen.
Ein besonders hohes Risiko, an einer Wochenbettdepression zu erkranken, haben Frauen, die schon einmal unter psychischen Erkrankungen gelitten haben oder in der Schwangerschaft zu ängstlichen und depressiven Gedanken neigten. Auch Depressionen in der Familie erhöhen das Erkrankungsrisiko. Wie Oddo-Sommerfeld in Studien zeigen konnte, erhöhen zudem bestimmte Persönlichkeitsmerkmale das Risiko für eine Wochenbettdepression: „In der Regel sind das sehr autonome, gewissenhafte und perfektionistische Frauen.“ Es falle ihnen häufig schwer, mit einem Kind nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben. Zudem ist die Erkrankung der Psychologin zufolge häufiger bei Frauen aus höheren Bildungsschichten anzutreffen.
Wochenbettdepressionen lassen sich gut behandeln
Der soziale Rückhalt der Mutter spielt nach Einschätzung von Oddo-Sommerfeld ebenfalls eine Rolle. Ein zuverlässiger Krankheitsschutz ist er aber nicht, wie Professor Reif erklärt. „Klassische postpartale Depressionen finden sich auch bei Frauen, die in einem perfekten Umfeld leben, wo der Partner voll dahintersteht, sich alle freuen und die Geburt glatt ging.“ Der Experte betont aber auch, dass sich Wochenbettdepressionen gut behandeln lassen. Meistens werde dabei eine Kombination aus Medikamenten und Psychotherapie eingesetzt. In schweren Fällen gehe es auch darum, wieder den Bezug zum Kind zu bekommen. Je nach Medikamentenauswahl könne die Mutter ihr Baby auch während der Behandlung stillen, so Reif.
Besonders wichtig ist es in jedem Fall, möglichst schnell professionelle Hilfe zu suchen. Oddo-Sommerfeld betont: „Wenn man die Depression nicht rechtzeitig behandelt, hat das massive Auswirkungen auf das Kind, die ganze Familie und die Partnerschaft." Um betroffenen Frauen schnell zu helfen, hat sie daher eine telefonische „Wochenbettdepression-Hotline“ ins Leben gerufen.
Foto: © S.Kobold - Fotolia.com