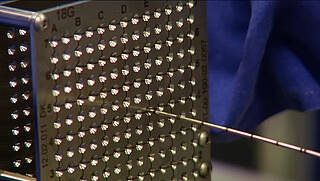Das IQWIG spricht sich gegen einen generellen Test des PSA-Wertes aus – Foto: ©jarun011 - stock.adobe.com
Beim einem generellen PSA-Screening wiegt der Nutzen den Schaden nicht auf. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) nach Auswertung der weltweiten Studienlage zu dem Thema. Der PSA-Test soll zur Früherkennung von Prostatakrebs dienen.
Zwar nutzt eine Reihenuntersuchung mittels PSA-Test einigen Männern, indem ihnen eine metastasierte Krebserkrankung erspart bleibt oder diese nach hinten verschoben wird, heißt es im Abschlussbericht des Instituts. Zugleich müssen aber deutlich mehr Männer damit rechnen, wegen Überdiagnosen und damit einhergehender Übertherapie dauerhaft inkontinent oder impotent zu werden - und das in relativ jungen Lebensjahren.
Künftig Risiko-basierte Screening-Strategien?
Bei der Anhörung zum im Januar erschienenen Vorbericht diskutierte das IQWiG mit Experten, ob und wie die Schäden eines PSA-Screenings mithilfe von Risiko-adaptierten Strategien verringert werden könnten, ohne gleichzeitig den Nutzen zu beeinträchtigen.
"Maßnahmen wie die Beschränkung der Biopsie auf Männer mit einem hohen Risiko oder die Anwendung neuer Biopsie-Methoden sind vielversprechende Ansätze, um das Nutzen-Schaden-Verhältnis des PSA-Screenings perspektivisch zu verbessern", betont IQWiG-Leiter Jürgen Windeler. "Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen allerdings Studien, die dies belegen." Daher änderte sich die Gesamtbewertung nicht.
Prostatakrebs häufigste Tumorerkrankung des Mannes
Das Prostatakarzinom ist in Deutschland mit 23 Prozent aller Krebserkrankungen die häufigste Tumorerkrankung des Mannes. Jährlich sterben etwa 14.000 Männer an den Folgen von Prostatakrebs. Ziel des Screenings ist es, Prostatakarzinome mit einem hohen Progressionsrisiko in einem frühen Stadium zu entdecken, um den Krebs zu heilen.
Derzeit kommen zwei Screening-Tests zum Einsatz: die digital-rektale Untersuchung und der Test auf das prostataspezifische Antigen (PSA). Die digital-rektale Untersuchung ist Teil des gesetzlichen Früherkennungsangebots für Männer ab dem 45. Lebensjahr, der PSA-Test nicht.
Weltweit 400.000 Studien-Teilnehmer
Die jetzt vorliegende IQWiG-Nutzenbewertung beruht auf der Auswertung von 11 randomisierten kontrollierten Studien mit weltweit mehr als 400.000 Teilnehmern. Alle diese Studien vergleichen ein Prostatakarzinom-Screening mittels PSA-Test mit keinem Screening auf Prostatakrebs.
Nach Auswertung der Studienlage kommt das IQWiG zu dem Ergebnis, dass das Prostatakarzinom-Screening mittels PSA-Test einigen Männern mit einem Prostatakarzinom nutzt, indem es ihnen eine Belastung durch eine metastasierte Krebserkrankung erspart oder diese zeitlich verzögert. Dieser Vorteil tritt erst nach mehreren Jahren auf. Es ist zudem unklar, ob das Screening bei diesen Männern insgesamt zu einer Lebensverlängerung führt.
PSA-Screening: Nutzen wiegt den Schaden nicht auf
Zugleich schadet das PSA-Screening den überdiagnostizierten Männern (Männern mit einem Prostatakarzinom, das keiner Behandlung bedarf) und den Männern mit einem falsch-positiven Screeningbefund (Männern ohne Prostatakarzinom) mehr oder weniger unmittelbar. Den überdiagnostizierten Männern drohen Therapie-Komplikationen wie Inkontinenz und Impotenz.
Männer mit einem falsch-positiven Befund erfahren einen Schaden in Form eines besorgniserregenden Testergebnisses, das eine Prostatabiopsie nach sich zieht. Fazit: Beim PSA-Screening wiegt der Nutzen den Schaden nicht auf. Insgesamt schadet das Prostatakarzinomscreening mittels PSA-Test deutlich mehr Männern durch Überdiagnosen als es Männern durch eine frühere Diagnose des Krebses nutzt.
Urologen kritisierten IQWiG-Bericht
Die Deutsche Gesellschaft für Urologie übte Kritik an dem Schlussbericht. Das vom IQWiG negativ bewertete systematische PSA-Screening aller Männer werde weder von den medizinischen Fachgesellschaften, noch den gängigen Leitlinien, noch von Patientenvertretern gefordert oder empfohlen.
Gemäß der Leitlinien erfolge eine risikoadaptierte PSA-Diagnostik als Baustein der Prostatakarzinom-Früherkennung. Diese solle allen informierten und interessierten Männern als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen offenstehen. Es sei nun Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), das Thema der Erstattungsfähigkeit zu überprüfen. Der medizinische Nutzen des PSA-Tests bleibe unbestritten.
Foto: Adobe Stock/jarun011