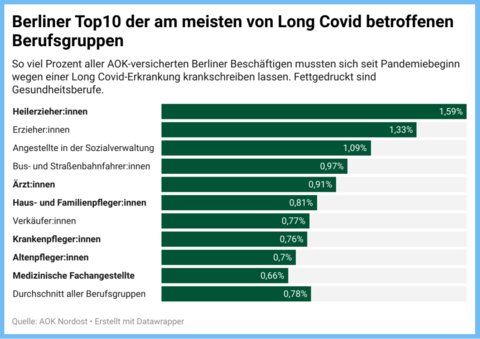Paradigmenwechsel in der Parkinson-Therapie

Prof. Dr. med. Andreas Kupsch
Herr Professor Kupsch, was bedeutet heute die Diagnose Parkinson?
Kupsch: Die Einführung von L-Dopa in den Sechzigerjahren war ein Durchbruch in der Parkinson-Therapie, gefolgt von den Dopamin-Agonisten in den Siebzigern. Seither hat sich die Lebenserwartung der Parkinson-Patienten weitgehend normalisiert und die Lebensqualität in allen Krankheitsphasen deutlich verbessert.
Parkinson ist nach wie vor unheilbar. Wie sieht ein typischer Krankheitsverlauf aus?
Kupsch: Wenn heute ein Patient typischer Weise mit 60 Jahren erkrankt, dann kann er unter medikamentöser Therapie rund fünf bis sieben Jahre relativ unbeeinträchtigt und oft auch symptomfrei leben. Wir nennen das die Honeymoon-Phase.
Honeymoon ist ein schönes Wort. Aber was kommt dann?
Kupsch: Im längeren Verlauf entwickeln sich Komplikationen. Neben dem Zittern auf einer Körperseite, dem so genannten Ruhe Tremor, treten jetzt trotz Medikamentenanpassungen Symptome auf beiden Körperhälften sowie Unbeweglichkeitsphasen und oftmals auch Schmerzen auf. Und es kommt zu unwillkürlichen Überbewegungen, sogenannten Dyskinesien, und einem plötzlichem Wechsel zwischen on- und off. Das heisst, der Patient kann sich von einer Sekunde auf die andere nicht mehr bewegen und zum Beispiel nicht mehr in den Bus einsteigen, obwohl er eigentlich möchte. Wie wir heute wissen, weisen diese Patienten im Spätstadium auch kognitive Defizite auf.
Für einen Patienten, der etwa wie Michael J. Fox mit Mitte 30 an Parkinson erkrankt, sind sieben gute Jahre nicht gerade viel.
Kupsch: Wer früh ein Parkinson-Syndrom entwickelt, sprich unter 50 Jahren erkrankt, der ist noch viele Jahrzehnte geistig fit und kann meist ein recht normales Leben führen. Allerdings sind diese Patienten dauerhaft auf Medikamente angewiesen und entwickeln aufgrund des Fortschreitens der Erkrankung meist schon sehr früh Dyskinesien und Wirkungsfluktuationen, wie zum Beispiel die geschilderten on/off-Perioden.
Unter Wirkungsfluktuation verstehen Sie die schwankende Medikamentenwirkung?
Kupsch: Bei Parkinson sterben die Dopamin-produzierenden Nervenzellen in der Substantia nigra, einer schwarzen Struktur im Mittelhirn, nach und nach ab. Anfangs kann der Dopamin-Mangel gut durch Medikamente ersetzt werden. Leider ist aber der Zellschwund nach etwa sieben Jahren so weit fortgeschritten, dass eine Speicherung des Dopamins bzw. von L-DOPA nicht mehr ausreichend möglich ist. Dadurch kommt es zu deutlichen Schwankungen der Medikamentenwirkung und damit der Symptomunterdrückung, die an die Halbwertzeit von L-Dopa von etwa zwei bis vier Stunden gebunden sind.
Deshalb gibt man Dopamin-Agonisten?
Kupsch: Mit den Dopamin-Agonisten treten die Schwankungen seltener und später auf. Daher werden vor allem jüngere Patienten damit behandelt. Im Spätstadium ist es meist eine Kombinationstherapie.
Lange galt, dass man mit der Behandlung möglichst spät beginnen soll. Gilt das noch?
Kupsch: In dieser Hinsicht hat es einen echten Paradigmenwechsel gegeben. Grosse amerikanische Studien wie die so genannte ELLDOPA-Studie aus 2004 haben gezeigt, dass eine frühe Behandlung mehr Vor- als Nachteile bringt. In Deutschland werden augenblicklich die ärztlichen Leitlinien dementsprechend angepasst. Das gilt übrigens nicht nur für L-Dopa, sondern auch für den Mao-B-Hemmer Rasagilin oder sogar für alte Medikamente wie den Glutamat-Antagonisten Amantadin. Derzeit wird diskutiert, ob diese Stoffe sogar das Fortschreiten der Erkrankung verzögern können.
Eine Behandlungsalternative für besonders schwer betroffene Patienten ist die Tiefen Hirnstimulation. Welche Rolle spielenHirnschrittmacher tatsächlich in der Parkinson-Therapie?
Kupsch: Die Hirnschrittmachertherapie ist ein Meilenstein, der grundsätzlich vergleichbar mit der Entdeckung von L-Dopa ist. Drei grosse internationale Studien, darunter eine aus Deutschland, haben gezeigt, dass die Hirnschrittmacher-Patienten eine deutlich bessere Lebensqualität aufweisen als medikamentös behandelte Patienten, zumindest im Spätstadium. Sie brauchen weniger Medikamente und leiden weniger an Überbeweglichkeit und Wirkungsfluktuationen.
Heisst das, die Hirnschrittmachertherapie verlangsamt möglicherweise den Krankheitsverlauf?
Kupsch: Im Tiermodell wurde bereits gezeigt, dass man mit Hirnschrittmachern sogar das Fortschreiten der Erkrankung hinauszögern kann. Dies auch klinisch auch nachzuweisen, ist allerdings sehr schwer. Dazu müsste man Hunderte homogen operierte Patienten einheitlich über viele Jahre beobachten und mit nicht-operierten Patienten vergleichen. Das ist kaum durchführbar.
Weit verbreitet ist die Therapie in Deutschland ohnehin noch nicht.
Kupsch: Sie müssen sich vorstellen, dass in Deutschland etwa zehn bis 20 Prozent der rund 250 000 Parkinson-Patienten für die Therapie Frage kommen, aber nur etwa zwei bis drei Prozent tatsächlich den Hirnschrittmacher bekommen.
Woran liegt das?
Kupsch: Die Therapie setzt eine etwa sechs- bis achtstündige Operation voraus, bei dem Neurochirurgen dem Patienten Elektroden in bestimmte Parkinson-Areale des Gehirns implantieren. Neurophysiologen und Neurologen nehmen dann die Einstellungen des Hirnschrittmachers patientenindividuell vor. Insofern ist die Hirnschrittmacher-Therapie ein sehr komplexes und auch personalintensives Verfahren. Daneben spielen jedoch auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Die Einführung von neuen Therapieverfahren erfordert die Bildung neuer Therapiepfade, und das braucht Zeit. Um das zu beschleunigen, müssen die betroffenen Patienten und die behandelnden Ärzte Äufklärungsarbeit leisten.
Kritiker bemängeln, dass die Hirnschrittmacher-Therapie Persönlichkeitsveränderungen mit sich bringen kann.
Kupsch: Die Kritik ist berechtigt, sie trifft aber leider auch auf die Medikamente und die Erkrankung selber zu. Die Medikamente, die wir bei Parkinsonkranken einsetzen, sind potenziell persönlichkeitsverändernd. Zwar stellen sie überwiegend die "alte", gesunde Persönlichkeit wieder her. Aber es können zum Beispiel auch Verwirrtheits-Zustände auftreten. Dopaminmangel und Persönlichkeit sind nicht einfach zu trennen.
Welche Rolle spielt Dopamin in unserem Gehirn?
Kupsch: Dopamin ist ein Botenstoff, der für das Belohnungssystem, die Informationsübertragung und auch für die Impulskontrolle zuständig ist. Bei Patienten mit Schizophrenie liegt zum Beispiel ein Dopamin-Überschuss vor. Und Parkinson-Patienten, die zu viel Dopamin bekommen, etwa dann, wenn ihre Speicher aufgebraucht sind, leiden oftmals unter Halluzinationen.
In der Parkinson-Forschung hat es immer wieder Durchbrüche gegeben. Worauf liegen die derzeit grössten Hoffnungen?
Kupsch: Die grösste Hoffnung ist, eines Tages den Zelltod zu stoppen oder neue Zellen zum Wachsen zu bringen. Schliesslich wissen wir heute, dass das Gehirn in der Lage ist, neue Zellen zu bilden. Versuche mit neurotrophen Faktoren, das Wachstum von bestimmten Neuronen anzuregen oder mit Kalziummodulatoren, den Zelltod aufzuhalten, laufen bereits. Die positiven Effekte von Nikotin, Koffein und Bewegung werden in diesem Zusammenhang ebenfalls erforscht. Ich sehe die Parkinsonerkrankung als eine Art Modellerkrankung für andere neurodegenerative Erkrankungen. Im Vergleich zur Alzheimer-Forschung sind wir in der Parkinsonforschung bezüglich Therapiemöglichkeiten aber sehr viel weiter.
Prof. Dr. med. Andreas Kupsch forscht seit Jahrzehnten auf dem Gebiet des Morbus Parkinson. Derzeit leitet er die experimentelle Basalganglien-Forschung und ist Initiator und klinischer Koordinator einer klinischen Forschergruppe an der Charité. Bis 2012 leitete er die Ambulanz für Bewegungsstörungen der Charité.
![]() Welt-Parkinson-Tag 2012
Welt-Parkinson-Tag 2012