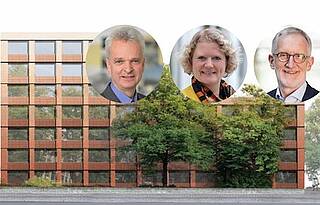Nanopartikel: Bestückt mit Antikörperfragmenten docken sie an Proteinen auf Krebszellen an. Das hat ein Forscherteam aus Dresden und Berlin in Zellkulturen und im Tiermodell bestätigen können. – Foto: HZDR/Michael Voigt
Einem interdisziplinären Forscherteam des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) und der Freien Universität Berlin ist es gelungen, bioverträgliche Nanopartikel zu entwickeln, die auf bestimmte Krebszellen regelrecht „abgerichtet“ sind. Ausgangspunkt für die HZDR-Forscher sind winzige Nanopartikel aus sogenannten dendritischen Polyglycerolen, die als Trägermoleküle dienen. „Diese Partikel können wir modifizieren und verschiedene Funktionen einführen“, erläutert Kristof Zarschler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am HZDR-Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung. „Wir bringen beispielweise auf dem Partikel ein Antikörperfragment an, das spezifisch an die Oberfläche von Krebszellen bindet. Dieses Antikörperfragment ist unsere zielsuchende Einheit, denn es leitet die Nanopartikel zu den Krebszellen.“
Nanopartikel docken an Krebszellen an
Erste Option dieser Partikel: Tumorzellen markieren und dadurch in bildgebenden Verfahren sichtbar machen. Dafür werden die winzig kleinen Trägermoleküle mit einem Antikörperfragment bestückt, das die Tumorzellen findet. Im Tierversuch mit Mäusen konnte nachgewiesen werden, dass zwei Tage nach Gabe der Nanopartikel das Tumorgewebe maximal mit ihnen angereichert ist. Die von den Forschern entwickelten Partikel docken an Proteinen an, die auf der Oberfläche bestimmter Tumorzellen (Brustkrebs, Kopf-Hals-Tumore) in großen Mengen vorkommen. „Wir konnten nachweisen, dass unsere Nanopartikel durch das verwendete Antikörperfragment bevorzugt mit diesen Krebszellen interagieren“, bestätigt Holger Stephan, Gruppenleiter am HZDR.
Krebsdiagnostik: Nanopartikel machen dreidimensionale Bilder möglich
Neben dem Antikörper bestückten die Wissenschaftler die Nanopartikel auch mit einem Farbstoff-Molekül und einem Radionuklid (radioaktives Atom). „Das Farbstoff-Molekül fluoresziert im Nah-Infrarot, sodass das emittierte Licht sogar durchs Gewebe dringt und unter einem entsprechenden Mikroskop sichtbar wird. Damit verrät uns der Farbstoff, wo die Nanopartikel genau sind“, sagt Kristof Zarschler weiter. Das Radionuklid, Kupfer-64, besitzt einen ähnlichen Zweck. Es sendet Strahlung aus, die Detektoren eines PET-Geräts (Positronen-Emissions-Tomographie) registrieren. Aus den Signalen lässt sich anschließend ein dreidimensionales Bild erstellen, das die Verteilung der Nanopartikel im Organismus sichtbar macht.
Perspektive: Wirkstoffe verschicken, die Tumorzellen gezielt zerstören
Zweite Option des jetzt erforschten Verfahrens: In künftigen Experimenten wollen die HZDR-Forscher testen, ob sich ihr Trägersystem mit noch weiteren Komponenten ausstatten lässt. Kristof Zarschler beschreibt die Pläne: „Man kann diese Nanopartikel beispielsweise mit einem Wirkstoff beladen. Das würde uns erlauben, ein Arzneimittel ganz gezielt zum Tumor zu bringen. Dabei könnte es sich etwa um ein therapeutisches Radionuklid handeln, das die Tumorzellen zerstört.“
Daran forscht das Helmholtz-Zentrum
Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) forscht auf den Gebieten Energie, Gesundheit und Materie. Ein Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit hat zum Ziel, Krebserkrankungen besser zu visualisieren und wirksamer zu behandeln.
Foto: AdobeStock/HZDR/Michael Voigt