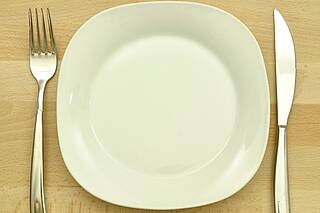Junger Mann mit Magersucht: Nie zufrieden mit dem eigenen Körper – Foto: © Adobe Stock/ iulianvalentin
Trotz Untergewicht empfinden sie sich als zu dick: Menschen, die an Magersucht leiden, haben ein verändertes Körperbildschema im Kopf. Deshalb fällt es ihnen auch schwer, ihr Verhalten als „krank“ einzustufen. Besonders häufig beginnt eine Magersucht oder Bulimie bei Mädchen in der Pubertät. Der Verlust an Körpergewicht beflügelt, er wird zur Sucht. In extremen Fällen hungern sich die Betroffenen zu Tode. Prominentes Beispiel war die Sängerin Karen Anne Carpenter. 1983 starb sie an den Folgen ihrer Magersucht.
Magersucht ist keine Frauenerkrankung
Doch nicht nur Mädchen und Frauen sind von Essstörungen betroffen. Schätzungsweise 25 bis 30 Prozent der Essstörungsdiagnosen betreffen Männer.
„Grundsätzlich zeigen Männer mit einer Essstörung ein ähnliches Verhalten wie betroffene Frauen“, weiß Professor Barbara Mangweth-Matzek von der Medizinischen Universität Innsbruck, die in der Fachzeitschrift „PiD Psychotherapie im Dialog“ über das verkannte Problem Essstörungen bei Männern berichtet. „Aus Angst, an Körpergewicht zuzunehmen, setzen sie alles daran, ihr Gewicht zu kontrollieren. Essattacken kompensieren Betroffene, indem sie erbrechen, Abführmittel missbrauchen, fasten oder exzessiv Sport treiben.“
Kaum einsichtsfähig
Betroffene beider Geschlechter schämten sich, stritten die Erkrankung ab und zögen sich zurück. Bei Männern komme hinzu, dass sie, so die öffentliche Wahrnehmung, unter einer typischen Frauenerkrankung leiden. Das komme einer doppelten Stigmatisierung gleich. „Dass Betroffene ihr Essstörungsleid von sich aus ansprechen, ist deshalb kaum zu erwarten. Gestörtes Essverhalten muss entweder routinemäßig oder bei Verdacht in der ärztlichen oder therapeutischen Praxis klar und empathisch erfragt werden“, sagt die Psychologin und Psychotherapeutin.
Muskelorientierte Essstörung bei Männern häufig
Laut der Expertin für Essstörungen gibt es noch weitere Unterschiede. Männliche Essstörungen seien oft „muskelorientiert.“ Die Betroffenen strebten nach einem übermäßig muskulösen Körper mit geringstmöglichem Fettanteil. Regelmäßiges Krafttraining sowie klare Essensvorgaben dominierten den Alltag. Damit verknüpft sei die sogenannte Muskeldysmorphie, ein gestörtes Selbstbild. „Dabei erscheint den Betroffenen die Ausprägung der eigenen Muskulatur im Vergleich zu ihrer Idealvorstellung nie ausreichend“, so Mangweth-Matzek
Das Erkennen von pathologischen Mustern im Zusammenhang mit Sport sei sehr schwierig. Zumal Männer häufig vor der Erkrankung übergewichtig seien. Eine gesteigerte sportliche Aktivität gepaart mit einer Diät werde dann als „gesundheitsbewusst“ und nicht als Anzeichen einer Essstörung gewertet.
Homosexualität spielt eine Rolle
Ein weiterer Unterschied betrifft die sexuelle Orientierung. So sind Essstörungen häufig bei homosexuellen und bisexuellen Männern zu finden: Laut Untersuchungen sind homosexuelle Männer sind mit zwei bis acht Prozent deutlich häufiger betroffen als heterosexuelle mit 0,3 bis zwei Prozent.
„Nicht-heterosexuelle Männer erleben ihren Körper oft als Objekt, welches einem schlanken, muskulösen Schönheitsideal unterworfen und damit auch häufig mit Körperunzufriedenheit assoziiert ist“, führt die Expertin als Erklärung an. Zudem könne die Essstörung als Folge von Stress auftreten, dem sie als Angehörige einer gesellschaftlichen Minderheit ausgesetzt sind.