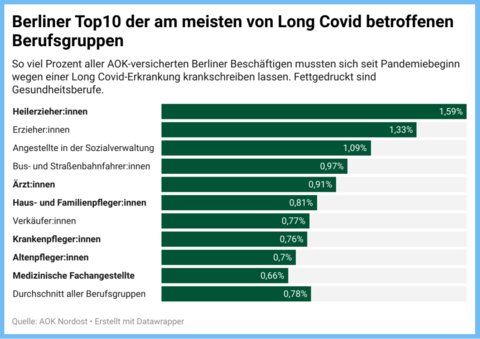Auf dem Weg zu einem demenzsensiblen Krankenhaus

KEH in Berlin-Lichtenberg: Wollen auf die besonderen Bedürfnisse von Patienten mit Demenz eingehen
Aktuell leben in Deutschland rund 1,5 Millionen Menschen mit einer Demenz, davon leiden zwei Drittel an Alzheimer. Laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft kommen jedes Jahr mehr als 300.000 Neuerkrankungen hinzu. Krankenhäuser bekommen diese Entwicklung bereits deutlich zu spüren. Insbesondere jene, die über geriatrische Spezialabteilungen verfügen. Eines davon ist das Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge (KEH) in Berlin. Das Haus in Lichtenberg verfügt über eine große Geriatrie, in der jedes Jahr mehr als 800 Patienten über 70 Jahre wegen verschiedenster Leiden behandelt werden. Für geriatrische Patienten mit der Nebendiagnose Demenz hat das Krankenhaus erst kürzlich eine eigene Station eröffnet. Dort ist zum Beispiel das Personal entsprechend geschult, die Betreuungsintensität höher und Flur und Zimmer sind mit Orientierungshilfen ausgestattet.
Robert-Bosch-Stiftung fördert das Engagement
Doch auch in den anderen Abteilungen des KEH werden immer öfter demenzkranke Patienten behandelt, sei es wegen eines Schlaganfalls oder eines Knochenbruchs. Schließlich sind 60 Prozent aller Patienten über 70. Deshalb hat man sich in Lichtenberg auf den Weg gemacht, das gesamte Krankenhaus „demenzsensibel“ zu machen. Als eines von bundesweit zwölf Krankenhäusern wird das KEH diesbezüglich von der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen des Modellprojekts „Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus“ gefördert. Das wissenschaftliche Projekt sieht zum Beispiel entsprechend qualifizierte Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen, das frühzeitige Erkennen einer Demenz, oder vielleicht sogar besser formuliert, von kognitiven Risiken und eine enge Einbindung der Angehörigen sowie von ehrenamtlichen Betreuungskräften vor. „Unser Anspruch ist es, künftig in allen Fachabteilungen die Bedürfnisse der Kranken mit Demenz zu berücksichtigen und dennoch eine bestmögliche Behandlung zu ermöglichen“, sagt Prof. Dr. AlbertDiefenbacher, Chefarzt der Psychiatrie. „Gleichzeitig wollen wir auch Mitpatienten, das Personal und vor allem die Angehörigen entlasten.“
Auf allen Stationen arbeiten „Pflegeexperten Demenz“
Bereits seit 2014 wurden am KEH 24 „Pflegeexperten Demenz“ für die Stationen ausgebildet, weitere 20 Mitarbeiter werden dieses Jahr die hausinterne Schulung erhalten. „Wir haben bereits heute auf jeder Station entsprechend ausgebildete Pflegekräfte, die sich um die besonderen Belange demenzkranker Patienten kümmern und auf den Stationen eine Art Multiplikatorenfunktion einnehmen“, berichtet Dipl.-Gerontologe Eckehard Schlauß, Leiter desDemenz- und Delirmanagement am KEH. Im Laufe des Jahres werde deren Zahl spürbar erhöht, zudem würden auf jeder Station entsprechende Fallkonferenzen eingeführt, etwa um Verbesserungspotenziale zu identifizieren, betont Schlauß.
Besonders wichtig für ein demenzsensibles Krankenhaus ist, dass Ärzte und Pfleger von Anfang an um die kognitiven Probleme ihrer Patienten wissen. Denn niemand kommt und sagt „ich habe Demenz.“ Darum führt das KEH in den kommenden Monaten schon in der Notaufnahme ein sogenanntes „geriatrisches Screening“ ein. Dabei handelt es sich um ein standardisiertes Verfahren mit simplen Fragen nach dem Namen, Geburtsdatum oder dem aktuellen Aufenthaltsort. Das ist keine Demenzdiagnostik, aber ein erster Anhaltspunkt für Ärzte und Pflege, ob es „Probleme gibt.“ Sollte dies der Fall sein, soll gleich am folgenden Tag der Sozialdienst eingeschaltet werden. „Gemeinsam mit dem Sozialdienst und den Angehörigen schauen wir dann, worum wir uns kümmern müssen, etwa ob die jetzige Wohnform des Patienten noch geeignet ist oder ob man über eine andere Lösung nachdenken sollte“, erläutert Gerontologe Schlauß.
Delir-Prävention für Demenz-Patienten
Patienten mit Demenz haben ohnehin schon einen höheren Betreuungsbedarf als andere Patienten. Erschwerend kommt hinzu, dass bei ihnen auch ein höheres Risiko für ein Delir besteht. Auf diese organisch bedingten Verwirrtheitszustände, die häufig nach einer Operation oder durch eine Infektion auftreten, hat man am KEH ein besonderes Auge geworfen. So hat das Psychiatrie-Team um Prof. Diefenbacher zwischen 2011 und 2012 eine Delir-Studie auf zwei chirurgischen Stationen durchgeführt und anschließend ein eigenes Delirmanagement im Haus etabliert. Ziel ist es, die Delirraten stationsübergreifend zu senken. Das Personal sorgt etwa dafür, dass der Patient besser schläft, frühzeitig mobilisiert und kognitiv aktiviert wird und dass er genug Flüssigkeit bekommt. „Eine intensivere Begleitung kann Hochrisikopatienten Sicherheit geben und helfen, ein Delir von vornherein zu vermeiden“, erklärt Diefenbacher das Konzept. Weil diese Interventionen besonders personalintensiv sind, überlegt das KEH, ob eine Unterstützung des Pflegepersonals auf den Stationen durch Freiwillige im Betheljahr möglich ist. Die Freiwilligen im Betheljahr, gedacht ist an 12 Teilnehmer, könnten zum Beispiel dafür sorgen, dass sich die Patienten in dem unübersichtlichen Komplex eines Krankenhauses besser zurechtfinden und immer ein offenes Ohr für Wünsche, Sorgen und Bedürfnisse finden.
Laut Psychiater Diefenbacher sollen mit dem umfassenden Behandlungskonzept nicht nur die Risiken und Belastungen, die ein Krankenhausaufenthalts für Demenzpatienten mit sich bringt, deutlich reduziert werden. „Der Aufenthalt soll auch als Chance genutzt werden, Kranke wegen der Demenz zu behandeln und die Versorgung nach der Entlassung dem individuellen Bedarf anzupassen“, sagt er. Hierfür ist der weitere Ausbau von Versorgungsnetzwerken etwa mit caritativen Einrichtungen im Stadtbezirk, insbesondere im Rahmen der Demenzfreundlichen Kommune Lichtenberg e. V. (DfKL) geplant.
Spezielle Angebote für Angehörige
Angehörige werden heute schon eng in die Behandlung mit einbezogen: Das Krankenhaus führt seit vergangenem Jahr spezielle Pflegekurse durch und ist auch noch nach der Entlassung für die Betroffenen da. So besucht ein vertrauter Krankenhausmitarbeiter die Familien ein halbes Jahr lang bis zu sechsmal zu Hause und gibt Hilfestellungen zu allem, was die Betreuung des Demenzkranken erleichtern könnte. „Das kann die Organisation eines Pflegebetts bis hin zum Umbau der Wohnung sein“, erläutert Demenzexperte Schlauß. Die AOK fördert dieses Angebot im Rahmen ihres Projekts „Pflege in Familien fördern (PfiFf)“, unabhängig davon, bei welcher Kasse der Patient versichert ist. Gemeinsam mit der AOK will das KEH künftig auch das Entlassungsmanagement weiter optimieren. Dafür will man unter anderem die Zusammenarbeit mit den Berliner Pflegestützpunkten intensivieren und Hemmschwellen abbauen. „Es reicht nicht einem Angehörigen eine Visitenkarte in die Hand zu drücken“, sagt Schlauß. Erfahrungen aus der Gerontopsychiatrie zeigten, dass man ein Hilfesystem brauche, was eher zugehend sei. „Darum fragen wir zum Beispiel die betreuende Familie, ob sich ein ehrenamtlicher Betreuungsdienst bei ihr melden kann. Denn wichtig für Angehörige ist, die Hürden so niederschwellig wie möglich zu halten.“
Foto: Dipl.-Gerontologe Eckehard Schlauß mit Patient (KEH)