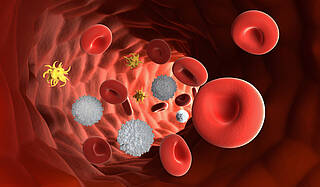– Foto: Adobe Stock/Wirestock
Die Gutenberg-Covid-19- Studie zeigt neue Erkenntnisse zu Long-Covid. Demnach geben bis zu 40 Prozent der mit SARS-CoV-2 infizierten Personen entsprechende Symptome an, die über mindestens sechs Monate andauern.
Betroffen sind nicht nur Personen mit schwereren Verläufen, sondern auch die weitaus größere Zahl der Infizierten mit milden oder asymptomatischen Verläufen und ohne medizinische Behandlung in der akuten Erkrankungsphase.
Fünf Prozent der Probanden waren infiziert
Eine eindeutige Definition von Long-Covid existiert bislang nicht. Um den Forschungsbedarf zu adressieren, haben zwölf Einrichtungen der Universitätsmedizin Mainz die multidisziplinäre Studie entwickelt.
Im Rahmen der Untersuchung wurden bei etwa fünf Prozent der 10.250 teilnehmenden Personen im Zeitraum Oktober 2020 bis Juni 2021 mittels PCR- und Antikörpertestungen eine wissentlich oder unwissentlich durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen.
40 Prozent der Patienten leiden an Long-Covid
40 Prozent der Befragten gaben an, über mindestens sechs Monate neu aufgetretene oder an Intensität zugenommene Symptome zu haben. Das heißt, sie leiden an Long-Covid. Etwa ein Drittel der Personen sagte aus, seit der Infektion nachhaltig in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt zu sein.
Häufig genannte Symptome waren: Abgeschlagenheit und Müdigkeit, Gedächtnis-, Schlafstörungen oder Atemnot und Kurzatmigkeit. Frauen waren mit rund 46 Prozent etwas häufiger von Spätfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion betroffen als Männer (rund 35 Prozent). Das Alter spielte für das Auftreten von Long-Covid kaum eine Rolle.
Zum Screening geören MRT und Bioproben
Um den Symptomkomplex von Long-Covid umfassend zu verstehen, sollen in einer Screening-Untersuchung, die auch eine MRT des Kopfes und die Gewinnung von Bioproben umfasst, vielfältige Daten erhoben werden. "Damit verfolgen wir das Ziel, das Krankheitsbild evidenzbasiert charakterisieren und definieren zu können", erklärt der Sprecher der Studienleitung, Prof. Philipp Wild, in einer Pressemitteilung.
Das beinhalte, betroffene Organe und Systeme, aber auch Risikofaktoren zu identifizieren. "Die systemmedizinische Untersuchung von molekularen Mustern wird uns helfen, die Pathomechanismen der Erkrankung zu verstehen. Um auch subklinische Veränderungen zu erfassen, die sich nicht oder noch nicht in einer Erkrankung manifestiert haben, untersuchen wir die Teilnehmenden unabhängig vom Auftreten von Symptomen", ergänzt Wild.