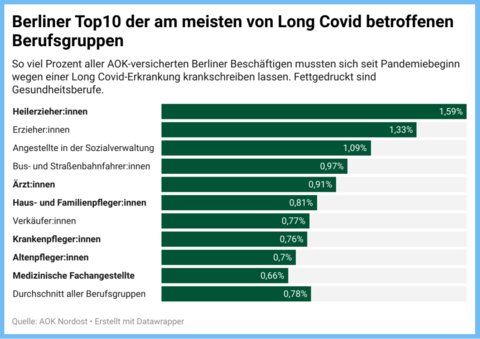Wo sich Depressive Hilfe holen

50 Prozent der Patienten mit Depressionen, die sich dazu aufraffen können, sich Hilfe zu holen, gehen als erstes zu ihrem Hausarzt. – Foto: AdobeStock/Alexander Raths
Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Rückzug, Resignation: Das sind typische Gefühlszustände von Menschen mit depressiven Episoden. Das Typische wie das Tückische an dieser schweren und oft lebensgefährlichen Krankheit ist, dass sie selbst ein wichtiges Hindernis darstellt, um sich aus dem Tief herauszuarbeiten und sich Hilfe zu organisieren. Und wer sich am Ende aufraffen kann, muss oft noch lange kämpfen und warten, bis er einen überhaupt Therapieplatz bekommt.
Nur ein Drittel der Depressiven schafft es, sich schnell Hilfe zu organisieren
Im Durchschnitt dauert es 20 Monate, bis sich Menschen mit Depression Hilfe suchen. Das zeigt das jetzt von der „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“ zum neunten Mal vorgelegte „Deutschland-Barometer Depression“. Demnach gibt es innerhalb der Patientengruppe mit Depressionen offenbar große Unterschiede: Ein Drittel aller Betroffenen sucht sich sofort Hilfe. Bei 65 Prozent hat es hingegen länger gedauert, bis sie professionelle Unterstützung in Anspruch genommen haben – hier im Schnitt sogar 30 Monate.
Wenn sich die Betroffenen Hilfe suchen, wenden sie sich mehrheitlich zunächst an ihren Hausarzt (51 Prozent). Jeder vierte Patient (25 Prozent) geht direkt zum Facharzt, jeder fünfte (19 Prozent) zum Psychotherapeuten. Heilpraktiker geben nur 0,7 Prozent der Befragten mit Depression als erste Anlaufstelle an.
Depressionen: Oft wochenlange Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt oder Therapeuten
Doch wer es schafft, noch – oder wieder – die Kraft aufzubringen, sich der Krankheit zu stellen, ihre lähmende Schwere zu überwinden und Hilfsangebote zu recherchieren, hat oft das Gefühl, gegen immer dieselbe Wand zu rennen. Therapeuten abtelefonieren und Absagen kassieren: Ausgerechnet die Suche nach Hilfe erleben viele Patienten als oft enttäuschend und zusätzlich deprimierend. In der Befragung berichten viele Betroffene im Rückblick von wochenlangen Wartezeiten, ehe eine Behandlung beginnen konnte. So gaben die Teilnehmer der Befragung an, bei Fachärzten im Schnitt acht Wochen auf ein Erstgespräch gewartet zu haben; bei Psychotherapeuten waren es im Schnitt sogar zehn Wochen. Durchschnittlich fünf Therapeuten mussten die Betroffenen nach eigener Erinnerung kontaktieren, ehe sie einen Termin bekamen.
Warum es für Depressive so schwer ist, sich Hilfe zu suchen
„Die Depression ist eine schwere, oft auch lebensbedrohliche Erkrankung. Dass ein großer Teil der Betroffenen Monate oder sogar Jahre braucht, um sich Hilfe zu suchen, ist besorgniserregend“, sagt Ulrich Hegerl, der Vorsitzende der „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“ in Leipzig. Bei einer so leidvollen Erkrankung wie der Depression, die zudem mit hoher Suizidgefährdung einhergeht, sei es nicht akzeptabel, dass dann noch zusätzlich die langen Wartezeiten einen Therapiebeginn verzögerten.
Gründe für diese teils extreme Zeitspanne zwischen Auftreten der Krankheit und Beginn der Heilbehandlung sind laut Depressionshilfe vielschichtig: Dazu gehörten die für eine Depression typische Hoffnungslosigkeit und Antriebslosigkeit, aber auch Versorgungsengpässe und die immer noch bestehende Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, sagt der Vorsitzende Hegerl.
Psychotherapie und Medikamente: Die zwei wichtigsten Säulen der Depressions-Behandlung
Gemäß der Nationalen Versorgungsleitlinie sind Medikamente und/oder Psychotherapie die beiden wichtigsten Behandlungssäulen bei depressiven Erkrankungen. Von den Befragten, die aktuell erkrankt sind, bekommen 62 Prozent Medikamente und 48 Prozent Psychotherapie; 35 Prozent erhalten eine Kombination aus beidem. 8 Prozent der Betroffenen besuchen Selbsthilfegruppen, 7 Prozent nutzen digitale Gesundheitsangebote.
Alternativmedizin wird selten von Depressions-Patienten genutzt
Alternative, nicht-evidenzbasierte Verfahren wie Homöopathie, Heilsteine oder Darmreinigung nutzen 9 Prozent der Erkrankten und geben dafür jährlich im Schnitt 227 Euro aus. Als Hauptgrund wird genannt, selbst etwas zu der Behandlung beitragen zu wollen (57 Prozent). Bei der Wahl von Methoden der Alternativmedizin spielen auch lange Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz oder Zweifel an der Schulmedizin eine Rolle (je 19 Prozent).
Wichtig für Depressive: Die wissenschaftlich bestätigte Wirksamkeit von Therapieverfahren
Insgesamt ist den Befragten wichtig, dass es für den gewählten Behandlungsweg wissenschaftliche Wirksamkeitsbelege („Evidenz“) gibt. So gaben 78 Prozent der Befragten mit Depressionen an, dass ihnen wissenschaftliche Wirksamkeitsbelege bei der Wahl der Behandlung wichtig seien.
Informations- und Hilfsangebote für Menschen mit Depression
- Informationen zur Krankheit, Selbsttest, Kontakte für Anlaufstellen auf der Website der Deutschen Depressionshilfe
- deutschlandweites Info-Telefon Depression: 0800 33 44 5 33 (kostenfrei)
- kostenfreies Online-Programm für Menschen mit leichteren Depressionsformen in 15 Sprachen (unter anderem Ukrainisch)
- fachlich moderierte Online-Foren zum Erfahrungsaustausch für Erwachsene www.diskussionsforum-depression.de und junge Menschen ab 14 Jahren www.fideo.de