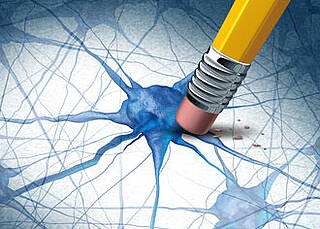Wenn sich das Kind nach dem Schädel-Hirntrauma verändert

Ein Schädel-Hirn-Trauma passiert schnell. Jedes fünfte Kind leidet an Langzeitfolgen
Ein kurzer Zusammenstoß auf dem Sportplatz und schon ist es passiert: Das Kind hat eine Gehirnerschütterung. In der Regel stecken Kinder ein Schädel-Hirn-Trauma gut weg und sind nach spätestens ein paar Wochen wieder ganz die alten. Schätzungsweise 20 Prozent der Kinder verändern sich jedoch dauerhaft in ihrem Verhalten und der geistigen Leistungsfähigkeit: Die Kinder sind ständig müde, klagen über Kopfschmerzen oder können sich viel schlechter konzentrieren als vor dem Unfall. Aufgaben wie zum Beispiel rechnen, die sie früher mühelos bewältigt haben, fallen plötzlich schwer.
Mikroschäden im Gehirn
Ärzte können im MRT meist keine Auffälligkeiten feststellen. Dennoch sind diese Kinder nicht gesund: Es kann nämlich sein, dass das Schädel-Hirn-Trauma Mikrostrukturen im Gehirn in Mitleidenschaft gezogen hat – etwa lange Nervenfasern, die Areale des Gehirns verbinden. Auch die Weiße Substanz, die einzelne Hirnregionen voneinander isoliert, kann durch den Unfall oder Sturz Schaden genommen haben und zu Problemen in den Denkvorgängen führen.
Neues Therapieangebot in Dresden
Für solche psychologischen Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas wird am Universitätsklinikum Dresden gerade ein ambulantes Therapieangebot geschaffen. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 15 Jahren, die aufgrund eines Schädel-Hirn-Trauma stationär im Universitätsklinikum behandelt wurden. Die Dresdner Wissenschaftler wollen das Projekt wissenschaftlich begleiten, so dass die neuen Erkenntnisse bundesweit zur Verfügung stehen.
Neurofeedback verbessert Aufmerksamkeit
Im Fokus des Projekts steht das Neurofeedback, eine Methode, die zum Beispiel auch bei ADHS angewendet wird. Ziel des Neurofeedbacks ist es, diese von kleinen Läsionen verursachten Defizite durch ein gezieltes Training auszugleichen, indem die mit Aufmerksamkeit verbundene Gehirnaktivität erhöht wird. Dafür wird die mit fünf Elektroden gemessene Gehirnaktivität in ein einfaches Computerspiel – etwa ein Autorennen – umgewandelt. Mit einem höheren Konzentrationslevel geht eine Erhöhung der Gehirnaktivität einher – dadurch lässt sich beim Neurofeedback das Autorennen steuern. Durch ein intensives Training besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich auch generell Fortschritte beim Leistungsvermögen erreichen lassen.
Die jungen Patienten können so lernen, ihre Konzentration bewusster zu steuern. Der Therapeut erarbeitet mit dem Patienten Konzentrationsstrategien, die auch im Alltag nutzbar sind. Das Training wird durch psychotherapeutische Elemente unterstützt. Um eine bedeutsame Verringerung der Aufmerksamkeitsprobleme in verschiedenen Bereichen zu erreichen, findet das Neurofeedback acht Wochen lang je zweimal wöchentlich statt.
Nachsorge von Kindern mit Schädel-Hirn-Trauma verbessern
Initiatoren des Projekts sind die Kliniken für Kinderchirurgie, für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die Abteilung für Neuropädiatrie des Universitätsklinikums Dresden. Mit dem Vorhaben wollen die Wissenschaftler einerseits die Nachsorge für Kinder mit Schädel-Hirn-Trauma verbessern und andererseits neue Erkenntnisse über die Spätfolgen eines Schädel-Hirn-Traumas gewinnen.
Foto: pixabay