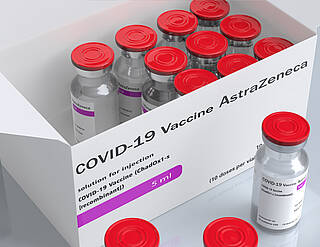Was bei Verdacht auf Hirnvenenthrombose zu tun ist

Schwer verlaufende Hirnvenen- und Sinusthrombosen sind lebensbedrohlich und gehören auf die Neuro-Intensivstation
Hirnvenenthrombosen und Sinusthrombosen waren bislang nur in Expertenkreisen bekannt. Nun bestimmen diese seltenen Formen von Schlaganfällen die Presse-Schlagzeilen. Auffällig häufig waren die lebensbedrohlichen und zum Teil tödlichen Ereignisse nach einer Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca aufgetreten, auffällig häufig bei jüngeren Frauen. Deutschland, Frankreich und Kanada haben deshalb eine Altersbeschränkung festgelegt, wonach nur Personen über 60 Jahre damit geimpft werden sollen. In Dänemark darf das Vakzin momentan überhaupt nicht mehr verimpft werden.
EMA-Vertreter sieht Zusammenhang
Während die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Vorfälle noch prüft und bis dahin die „Unschuldsvermutung“ gilt, scheint für den Leiter der EMA-Impfabteilung der Marco Cavaleri die Sache bereits klar zu sein. „Meiner Meinung nach können wir mittlerweile sagen, dass es klar ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt“, sagte Cavaleri mit Blick auf die Hirnvenenthrombosen nach AstraZeneca-Impfungen in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Il Messaggero“.
Einen kausalen Zusammenhang zwischen Impfung und Hirnvenen- und Sinusthrombosen (CVST) hält auch Prof. Dr. med. Julian Bösel für nicht ausgeschlossen, wenn auch noch nicht für erwiesen. Bösel ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für NeuroIntensiv- und Notfallmedizin (DGNI) und hat am Dienstag Stellung zum „Umgang mit der Situation“ bezogen.
Analogien zu Heparin-induzierten Thrombozytopenie (HIT)
Vieles sei noch nicht ganz verstanden, jedoch verwiese er auf Erkenntnisse aus der Gerinnungsforschung. Diese legten als möglichen Pathomechanismus eine sogenannte Vakzine-induzierte prothrombotische Immunthrombozytopenie (VIPIT) nahe, bei der durch die Impfung immunvermittelt Antikörper gegen Thrombozytenantigene gebildet werden. „In Analogie zur Heparin-induzierten Thrombozytopenie (HIT) kann es so Fc-Rezeptor-vermittelt zu einer Thrombozytenaktivierung und Thrombose kommen“, schreibt Bösel. Übersetzt bedeutet das: Das Immunsystem bekämpft die körpereigenen Blutplättchen, die dann zu ebenjenen Thrombosen im Gehirn führen. Warum eine Impfungs-assoziierte Thromboseneigung vor allem die Hirnvenen betreffen sollte, sei „noch nicht gänzlich zu verstehen“, so Bösel.
Anzeichen für Hirnvenenthrombose
In der Stellungnahme gibt die DGNI wichtige Hinweise, wie Hirnvenen- und Sinusthrombosen zu diagnostizieren und zu therapieren sind.
Erste Anzeichen sind demnach Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit/Erbrechen, epileptische Anfälle meist 5 bis 14 Tage nach der Impfung.
Bei ausreichend klinischem Verdacht sollten Ärzte die Diagnose mittels MRT und MR-Venografie sichern. Außerdem sollte ein großes Blutbild gemacht werden - inklusive Fragmentozyten; Gerinnung inklusive INR, aPTT, Fibrinogen, D-Dimere; klinische Chemie, LDH, Haptoglobin sowie HIT-Diagnostik.
Basis-Behandlung mit Blutverdünnern
Sobald die Diagnose CVST gestellt worden sei, sollten Patienten mit Blutverdünnern behandelt werden. Die Antikoagulation sollte aber bis zum HIT-Ausschluss nicht durch Heparin erfolgen, sondern durch Argatroban, Danaparoid oder den direkten Antikoagulanzien (NOAKS). Bei positiver HIT-Diagnostik sollten Ärzte die intravenöse Gabe von Immunglobulinen in Erwägung ziehen.
Die Fachgesellschaft weist außerdem darauf hin, dass Hirnvenen- und Sinusthrombosen Schlaganfälle sind und darum auf einer Stroke Unit behandelt werden müssen. Schwere Verläufe gehörten dagegen auf die Neuro-Intensivstation. Kennzeichen eines schweren Verlaufs sind demnach raumfordernde Stauungsinfarkte oder -blutungen, Hirnödem, epileptische Anfallsserien oder Status epilepticus. Wichtig sei, so Bösel, rechtzeitig an eine Verlegung zu denken, da es sich um lebensbedrohliche Komplikationen handle. Auf einer Neuro-Intensivstation können die Patienten zum Beispiel dauerbeatmet und an ein Neuromonitoring angeschlossen werden. Bei raumforderndem Hirnödem empfehlen die Experten, rechtzeitig eine chirurgische Dekompression in Betracht zu ziehen. Bei der OP wird die Schädeldecke gelöst, um dem geschwollenen Gehirn mehr Platz zu schaffen.