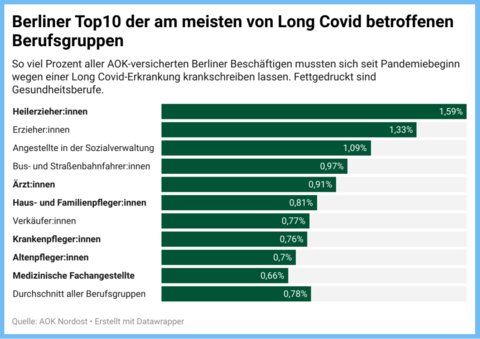Warum Depressionen bei Frauen häufiger diagnostiziert werden als bei Männern

Depressionen können sich bei Frauen und Männern sehr unterschiedlich äußern – Foto: Antonioguillem - Fotolia
Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer Depression. Dabei sind Frauen offenbar doppelt so häufig betroffen wie Männer. Für diese Unterschiede gibt es mehrere Erklärungsansätze. Allerdings konnte noch keiner von ihnen das Phänomen hinreichend begründen. Eine häufig geäußerte Vermutung ist, dass Depressionen bei Frauen nur schneller erkannt werden. So sprechen Frauen eher über ihre Ängste und Stimmungsschwankungen und werden dadurch von den Ärzten schneller als „depressiv“ eingeordnet, während Männer ihre Probleme eher auf organische Ursachen schieben. Hinzu kommt, dass Männer dazu neigen, ihre depressiven Symptome durch Suchtverhalten oder Aggressionen zu kompensieren.
Männer sterben häufiger durch Suizid
Dafür, dass Männer genauso häufig an Depressionen leiden wie Frauen, diese nur länger kaschieren, spricht auch die Tatsache, dass sich Frauen und Männer in der Häufigkeit angleichen, wenn man die Zahlen der schweren Depressionen betrachtet. Bemerkenswert ist auch, dass Männer öfter Suizid begehen. Gleichzeitig gibt es mehr Selbsttötungsversuche von Frauen. Da Männer aber eher zu drastischeren Mitteln wie Erschießen oder Erhängen greifen, sind ihre Suizidraten höher. Frauen hingegen nehmen eher Überdosen an Medikamenten und können häufig rechtzeitig gerettet werden. Somit könnten also die unterschiedlichen Zahlen auch an den Diagnosekriterien der Ärzte liegen. Dennoch scheint dies nicht ausreichend zu sein, um die Unterschiedlichkeiten zu erklären.
Sind Frauen weniger resilient?
Manche Forscher greifen daher auf hormonelle Gründe als Erklärung für die häufigeren Depressionen bei Frauen zurück. So treten Depressionen bei ihnen besonders häufig in Phasen hormoneller Umstellung auf, beispielsweise nach der Geburt eines Kindes („Wochenbett-Depression“) oder während der Wechseljahre. Jedoch scheinen Sexualhormone an sich weder pro- noch antidepressiv zu wirken. Studien zufolge scheint eine Depression vielmehr davon abzuhängen, wie sensibel das Gehirn auf die Hormonspiegel reagiert. Zudem ist man sich heute weitgehend einig, dass bei der Entstehung einer Depression immer biologische und psychosoziale Faktoren zusammenkommen.
So sehen manche Forscher grundsätzliche Unterschiede im Verhalten und Denken von Frauen und Männern als Grund für die verschiedenen Häufigkeitszahlen. Es wird auch angenommen, dass gerade junge Frauen eher zum Grübeln, zur negativen Selbstbewertung und zu hohen Ansprüchen an sich selbst neigen. Zudem haben Mädchen und junge Frauen häufiger ein negatives Körperbild. All das könnte sie vulnerabler für Depressionen machen.
Sozialer Status und Erfolg für Männer wichtiger
Und doch leiden auch viele Männer an Depressionen. So orientieren sie sich häufiger an Leistung und Erfolg und sind vor allem dann depressionsgefährdet, wenn ihr sozialer Status bedroht wird, wenn sie sich im Berufsleben übergangen fühlen oder sie das Gefühl haben, dass ihre Leistungen nicht ausreichend anerkannt werden. Weitere bekannte Risikofaktoren für Männer sind Single-Dasein, Scheidung oder Trennung, Homosexualität, Arbeitslosigkeit oder chronische Erkrankungen. Frauen sind häufiger gefährdet, wenn sie verheiratet sind, Kinder haben, nicht berufstätig sind oder kranke Angehörige pflegen. Natürlich treten bei diesen Punkten auch viele Überschneidungen auf. Zudem begünstigen bei beiden Geschlechtern schlechte ökonomische Bedingungen das Auftreten einer Depression.
Die Begründungen für die unterschiedlichen Diagnosehäufigkeiten von Depressionen bei Frauen und Männern sind also sehr verschieden, und keine scheint das Phänomen wirklich befriedigend zu erklären. Dennoch scheint es sinnvoll zu sein, bei gefährdeten Personen die spezifischen Risikofaktoren zu beachten und bei der Diagnosestellung auch auf Symptome wie Suchtverhalten oder Aggressionen zu achten. Zudem werden sich auch in Zukunft weitere Forschungen mit dem Thema beschäftigen.
Foto: © Antonioguillem - Fotolia.com