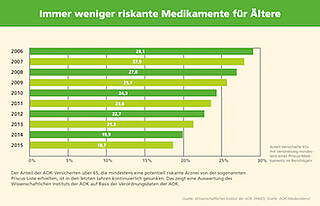Zeitlichen Abstand halten zu Nahrung, Milch und Säften: Viele Medikamente wirken nur auf nüchternen Magen – Foto: Robert Kneschke - Fotolia
Ein Hals-Nasen-Ohrenarzt aus Bayern staunte nicht schlecht, als er kürzlich zehn Globuli im Ohr einer kleinen Patientin fand. Ein Heilpraktiker hatte die Kügelchen wegen Ohrenschmerzen verordnet. Dass die Eltern dabei etwas gründlich missverstanden hatten, musst das Kind mit einer Mittelohrentzündung bezahlen. Dieser Fall zeigt, dass die Anwendung von Medikamenten weniger banal ist als viele denken. Während das Mädchen noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen ist, kann eine fehlerhafte Einnahme bei einer Krebserkrankung noch viel weitreichendere Folgen haben: Die Medikamente wirken nicht. Die Deutsche Hirntumorhilfe hat deshalb die Frage „Wie nehme ich die Chemotherapie richtig ein?“ zum Thema des Monats gemacht. Die Tipps sind zwar für Hirntumorpatienten gedacht, haben aber auch Gültigkeit für andere Patienten, die Medikamente einnehmen müssen.
Nüchtern heißt, drei Stunden nichts außer Leitungswasser
Bei einem Hirntumor wie dem Glioblastom wird Patienten das Chemotherapeutikum Temozolomid verordnet. Es soll laut Beipackzettel auf nüchternen Magen eingenommen werden. Das kann morgen oder abends sein, aber nach Möglichkeit immer zur gleichen Zeit. Damit der Magen wirklich leer ist, sollte die letzte Nahrungsaufnahme mindestens zwei Stunden zurückliegen, rät die Hirntumorhilfe. Andernfalls könnten sich noch Nahrungsrückstände im Magen befinden. Aber auch anschließend sollte noch eine Stunde gewartet werden, bevor wieder etwas gegessen wird. Gerade bei ballaststoffhaltigen Lebensmitteln wie Müsli sei ein größerer zeitlicher Abstand geboten. „Ballaststoffe können sich negativ auf die Wirksamkeit verschiedener Präparate auswirken, da sie deren Aufnahme über die Darmwand stark einschränken oder sogar verhindern können“, schreibt die Patientenorganisation.
Bei Milch, Müsli und Co. verpufft die Wirkung des Medikaments
Doch der Rat bezieht sich nicht nur aufs Essen, sondern auch aufs Trinken. Milch, Fruchtsäfte und andere kalorienhaltige Getränke haben im Magen vor, während und nach der Tabletteneinnahme nichts zu suchen. Selbst von Mineralwasser raten die Experten ab, weil es viele Salze enthält. Einige Wirkstoffe gehen mit den Salzen stabile Verbindungen ein. Sind diese Verbindungen zu groß, gelangen sie nicht in den Blutkreislauf und die Wirkung des Medikamentes ist verflogen. Milch und Joghurt haben wegen ihres hohen Kalziumgehalts eine ähnliche „verflüchtigende“ Wirkung. Und Grapefruitsaft kann ein Leberenzym hemmen und dadurch zu gefährlichen Reaktionen führen. „Sicherheitshalber sollte daher jede Kombination des Saftes oder der Frucht mit Medikamenten vermieden werden“, so die Hirntumorhilfe.
Bleibt also nur reines Leitungswasser, um das Medikament einzunehmen – und im Zweifel den Arzt oder Apotheker zu fragen.
Foto: © Robert Kneschke - Fotolia.com