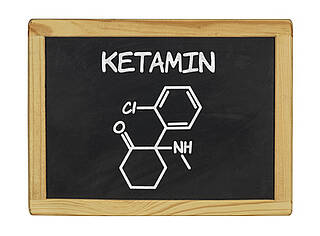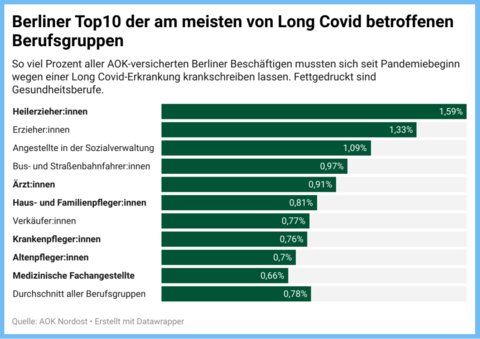Suizidrisiko bei Antidepressiva hängt vom Wirkstoff ab

Antidepressiva können vorübergehend das Suizidrisiko erhöhen. – Foto: Kzenon - Fotolia
Die Aufregung war groß, als vor einigen Jahren bekannt wurde, dass sich durch die Einnahme von Antidepressiva das Risiko für einen Suizid verstärken kann – besonders zu Beginn einer Therapie. Offenbar kann vor allem in den ersten 28 Tagen der Therapie sowie kurz nach Absetzen des Medikaments das Suizidrisiko erhöht sein. Experten plädieren daher dafür, die Patienten in dieser Zeit besonders aufmerksam zu beobachten. Eine Studie hat nun festgestellt, dass das Risiko auch von der verordneten Wirkstoffklasse abhängt.
Antidepressiva sollen die Suizidgefahr eigentlich senken. Doch verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass in den ersten Wochen einer Therapie die Selbstmordgefährdung nicht sinkt und unter Umständen sogar steigen kann. Besonders bei Kindern und Jugendlichen kann dieser scheinbar paradoxe Effekt eintreten. Bei ihnen scheinen hohe Dosen von Antidepressiva das Suizidrisiko zu erhöhen.
Antidepressiva erhöhen die Energie
Experten erklären sich dieses Phänomen dadurch, dass die antidepressive Wirkung der Medikamente erst nach einigen Wochen einsetzt, während die aktivierende Wirkung meistens sehr schnell zu spüren ist. So seien die Patienten immer noch depressiv, hätten aber plötzlich die Energie, die Pläne umzusetzen, die sie schon lange geschmiedet haben.
Forscher wollten dieses Phänomen nun genauer untersuchen und herausfinden, ob es Unterschiede des Suizidrisikos in Bezug auf die verordnete Wirkstoffklasse gibt. Für ihre Kohortenstudie untersuchten die Wissenschaftler um Carol Coupland von der Universität in Nottingham die Daten von 238.807 Patienten im Alter zwischen 20 und 64. Der Untersuchungszeitraum betrug über zwölf Jahre.
Wie sich zeigte, gab es einen signifikanten Unterschied zwischen der Behandlung mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) wie Citalopram und anderen, beispielsweise tetrazyklischen Antidepressiva. So war das Risiko für Suizidversuche unter Mirtazapin, einem tetrazyklischen Antidepressiva, gegenüber Citalopram signifikant erhöht. Bei Venlafaxin, einem selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI), sowie bei Trazodon, einem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer mit sedativen Eigenschaften, war das Suizidrisiko zwar auch etwas höher, allerdings war der Unterschied nicht signifikant. Bei trizyklischen Antidepressiva wie Doxepin und Amitryptillin war die Gefahr nicht erhöht.
Antidepressiva bei Kindern zurückhaltend verschreiben
Da gerade Kinder und Jugendliche von der vorübergehenden Erhöhung des Suizidrisikos unter Antidepressiva betroffen zu sein scheinen, plädieren Experten dafür, bei ihnen mit der Verschreibung von Psychopharmaka grundsätzlich zurückhaltend zu sein. In Deutschland ist es allgemein üblich, bei Kindern zunächst eine Psychotherapie zu versuchen, während Ärzte in den USA bisher weniger besorgt waren. Die Erfahrung zeigt, dass sich bei rund 50 Prozent der jungen Patienten die Symptomatik auch ohne Antidepressiva innerhalb von wenigen Monaten bessert. In einigen Fällen ist allerdings eine medikamentöse Therapie unumgänglich.
Foto: © Kzenon - Fotolia.com