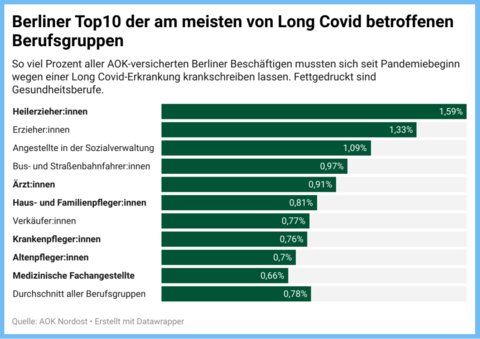Suizidrate unter Krebspatienten fast doppelt so hoch wie in Allgemeinbevölkerung

Angst vor unerträglichem Leid: Krebskranke nehmen sich öfter das Leben als ihre Mitmenschen – Foto: © AOK Mediendienst
Etwa eine halbe Million Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Der medizinische Fortschritt ermöglicht es zwar vielen Betroffenen, die Krankheit zu überleben oder länger damit zu leben. Doch die Lebensqualität verändert sich mit der Diagnose. Etliche Patienten leiden neben ihrer körperlichen Erkrankung an Zukunftsängsten oder Depressionen.
Aussichtslose Prognose führt am häufigsten in den Freitod
Wissenschaftler vom Universitätsklinikum Heidelberg und der Universität Regensburg zeigen nun auf, wie verzweifelt viele Betroffene sind: In der Studie wurden die Daten von 47 Millionen Krebspatienten aus Industrienationen ausgewertet. Danach ist die Suizidrate unter Krebspatienten fast doppelt so hoch wie in Allgemeinbevölkerung. Bei Patienten mit einer schlechten Überlebensprognose ist das Suizidrisiko sogar um das 3,5-fache erhöht. Wenn die Krebsdiagnose weniger als ein Jahr zurücklag, nahmen sich dreimal so viele Menschen das Leben verglichen mit der Allgemeinbevölkerung.
Auffällig ist außerdem, dass sich alleinlebende unverheiratete Krebspatienten öfter das Leben nehmen als verheiratete. Dass eine Ehe bzw. Partnerschaft vor einem Suizid schützt, ist bereits aus anderen Studien bekannt.
USA noch höhere Suizidraten als Europa
Die Forscher konnten zudem regionale Unterschiede finden. Nach der Datenlage ist die Suizidrate in den USA noch höher als in europäischen Ländern. Dies könnte damit zusammenhängen, dass viele US-Amerikaner nicht krankenversichert sind. Eine Krebserkrankung sei für amerikanische Patienten besonders häufig „mit hohen finanziellen Belastungen verbunden und einem erschwerten Zugang zu Hilfsangeboten wie einer psychologischen Beratung“, sagt Professor Michael F. Leitzmann, Direktor des Instituts für Epidemiologie und Präventivmedizin der Universität Regensburg.
Fazit aus den Daten
Um Krebspatienten besser zu unterstützen, fordern die Studienautoren eine besseren Zugang zu einer psychoonkologischen Versorgung – auch bei uns. „Ein Suizid kann häufig verhindert werden, wenn entsprechende Gedanken offen angesprochen werden und frühzeitig eine psychoonkologische oder sogar psychotherapeutische Betreuung eingeleitet wird“, sagt Dr. Till Johannes Bugaj, Leiter des psychoonkologischen Beratungsdienstes am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg. Der Zugang zu professioneller psychoonkologischer Begleitung und Nachsorge sollte daher ein integraler Bestandteil jeder Krebstherapie sein, so der Oberarzt.
„Viele Menschen mit Krebs sind nicht depressiv im psychiatrischen oder psychotherapeutischen Sinne, sondern haben ganz konkrete Angst vor Siechtum oder anderem schlimmem Leiden“, ergänzt Palliativmediziner Professor Bernd Alt-Epping vom Uniklinikum Heidelberg. Um das zu umgehen, entwickelten manche Patienten „Gedanken, das Leben vorzeitig enden zu lassen.“ Die Palliativmedizin könne jedoch Symptome lindern, verspricht der Professor, und unterstütze Menschen am Lebensende mit all ihren Möglichkeiten.
Doch reicht das um unheilbar kranken Menschen, eine Perspektive zu geben? Zukünftige Studien sollen auf Grundlage der Ergebnisse der Heidelberger und Regensburger Forschenden die Entstehung von Angst und Depression bei Krebspatienten genauer untersuchen, schreiben die Wissenschaftler. Ziel sei es, daraus Strategien und Maßnahmen für die Suizidprävention abzuleiten.
Die Studie “Suicide risk and mortality among patients with cancer” ist soeben in “Nature Medicine” erschienen