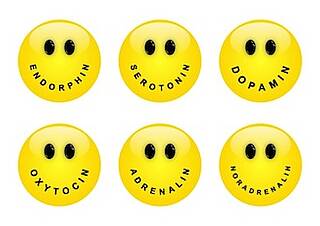Entgegen aller Einwände: Neuroleptika sind bei Psychosen das Mittel der Wahl, schreiben Psychiater im „American Journal of Psychiatry“ – Foto: ©Spectral-Design - stock.adobe.com
Rund 400.000 Menschen in Deutschland nehmen Neuroleptika ein. Die Psychopillen aus der Gruppe der Antipsychotika werden bei Psychosen wie Schizophrenie verordnet, aber auch wenn schwere Depressionen mit Wahnvorstellungen einhergehen oder Demenzkranke keine Ruhe finden. Dass die Mittel in die Chemie des Gehirns eingreifen, ist klar. Und dass es dabei zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt, liegt auf der Hand. Vor drei Jahren machten Untersuchungen Schlagzeilen, wonach sich durch eine längere Einnahme das Hirnvolumen mindert. Inzwischen hat sich dieser Verdacht bestätigt: Im Durchschnitt schrumpft das Gehirnvolumen unter Neuroleptika um ein bis zwei Prozent.
Nutzen versus Risiko
Trotzdem sind Neuroleptika nach wie vor ein zentraler Bestandteil der Behandlung akuter Psychosen. Aus Sicht von Prof. Peter Falkai von der Psychiatrischen Klinik am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München hat das gute Gründe: „Die Vorteile dieser Medikamente sind sehr gut belegt und wiegen die potenziellen Nebenwirkungen auf“, sagt er. Falkai ist Mitglied einer internationalen Expertengruppe, die das Gefahrenpotenzial von Neuroleptika untersucht haben. Im „American Journal of Psychiatry“ tragen die Psychiater den aktuellen wissenschaftlichen Stand zusammen und kommen zu dem Schluss, dass für die meisten Patienten der Nutzen der Verschreibung von Antipsychotika das Risiko überwiegt.
„Diese Erkrankungen sind geprägt von Denk- und Wahrnehmungsstörungen, zum Beispiel Wahnvorstellungen und die Menschen haben meist krankheitsbedingt Schwierigkeiten, Arbeit zu finden und langfristig soziale Beziehungen zu halten“, sagt Falkai. „Die meisten Patienten mit einer akuten Psychose profitieren von der Behandlung mit Neuroleptika, da sie so ihr Leben erfolgreicher bewältigen können.“ Allerdings sollten Ärzte die Medikamente nur in der kleinstnötigen Dosis verschreiben.
„Fluktuationen im Hirnvolumen gar nicht so ungewöhnlich“
Die Experten nehmen in ihrer Publikation „Contrary to Popular Belief, Antipsychotics Don’t Cause Long-Term Damage“ auch Stellung zur Hirnvolumenminderung, was viele Patienten verunsichert hat. Dieser Schwund ist ihrer Ansicht nach zu zwei Dritteln krankheits- und lebensstilbedingt. So führten neben Rauchen und Alkohol auch eine gestörte Informationsverarbeitung im zu einer „funktionellen Atrophie“, die in einer Hirnvolumenreduktion münde. Überdies seien Fluktuationen im Hirnvolumen gar nicht so ungewöhnlich, zum Beispiel in längeren Stressphasen oder durch Schlaflosigkeit, heißt es in dem Bericht.
Und einen weiteren Kritikpunkt weisen die Psychiater zurück, wonach das Leben Betroffener einen besseren Verlauf nimmt, wenn Neuroleptika – auch gegen ärztlichen Rat - abgesetzt wurden. „Überoptimistische Berichte über positive Krankheitsverläufe ohne Medikamente beruhen primär auf einigen wenigen wissenschaftlich mangelhaften Studien“, so die Autoren. Sicher hingegen sei, dass es bei akuten Psychosen im Augenblick keine Alternative zu Neuroleptika gebe. Wenn Psychosen regelmäßig wiederkehrten, sei sogar eine jahrelange Einnahme unerlässlich.
Foto: © Spectral-Design - Fotolia.com