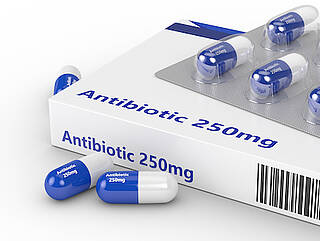„Multiresistente Erreger: Daran kann ein junger, gesunder Mensch sterben”

Prof. Ursel Heudorf über die Entstehung von Anibiotika-Resistenzen
Frau Professor Heudorf, viele Menschen glauben, dass sie selbst durch die häufige Einnahme von Antibiotika resistent werden.
Heudorf: Das kenne ich. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet die Aktion „Weniger ist mehr“ gestartet. Da kommen Leute an meinen Stand und sagen: „Ich nehme keine Antibiotika, damit ich nicht resistent werde“. Doch nicht der Mensch wird resistent, sondern die Erreger. Die haben verschiedene Mechanismen entwickelt, um Antibiotika unwirksam zu machen.
Sind diese Erreger nur gefährlich für alte, kranke oder immungeschwächte Menschen?
Heudorf: Nein. An einem multiresistenten Keim kann auch ein junger, gesunder Mensch sterben, der noch nie in seinem Leben Antibiotika eingenommen hat. Eine Besiedlung auf der Haut oder im Darm ist nicht gefährlich. Gefährlich wird es, wenn ein multiresistenter Keim über eine Wunde in die Blutbahn gelangt und sich dort dann ungehindert vermehrt.
So wie bei der 2016 in den USA an einem multiresistenten Keim verstorbenen Patientin?
Heudorf: Ja. Sie hatte den Keim aus Indien mitgebracht. Gerade in Schwellenländern gibt es viele Resistenzen. Man geht davon aus, dass bis zu 70 Prozent der Indien-Reisenden bei ihrer Rückkehr multiresistente Keime im Darm tragen. Resistente Keime sind auch in Italien, Griechenland und der Türkei verbreitet.
Warum gibt es gerade in Indien viele Resistenzen?
Heudorf: Das hat mit dem Entstehungsmechanismus zu tun. In Indien können sie an jeder Straßenecke Antibiotika kaufen. Deren Qualität ist nicht immer sichergestellt, und es kann davon ausgegangen werden, dass viele Menschen diese Medikamente falsch nehmen – unterdosiert oder zu kurz - was die Entstechung antibiotikaresistenter Erreger fördert.
Wenn viele Antibiotika in Umlauf sind, werden mehr Erreger resistent?
Heudorf: Ja. Resistenzen bilden sich so: Ein Mensch wird mit einem Erreger infiziert und erkrankt. Er nimmt ein Antibiotikum. Das bekämpft die Keime. Einen Überlebensvorteil hat das Bakterium, das beispielsweise durch eine Mutation genetisch so verändert ist, dass es dem Antibiotikum keine Angriffsfläche mehr bietet. Die anderen Keime werden vernichtet, diese resistenten Bakterien vermehren sich.
Der gleiche Effekt kann eintreten, wenn ein Antibiotikum in zu geringer Dosis oder nicht lange genug eingenommen wird. Es kann nicht die richtige Wirkkraft entfalten, besonders widerstandsfähige Erreger überleben und vermehren sich.
Es gibt Erreger, die die Fähigkeit entwickelt haben, ein Enzym zu bilden, das die Antibiotika ausschaltet. Oder die Kanäle in ihren Zellwänden schließen und sich so unangreifbar machen. Besonders gefährlich sind gram-negative Darmkeime, die ihre Resistenz-Gene über Zellbestandteile nicht nur an ihre eigenen Nachkommen sondern auch direkt an andere Bakterienarten im Darm weitergeben.
Wie kommt dieser resistente Keim aus dem Darm zu anderen Menschen?
Heudorf: Durch Kontakt- oder Schmierinfektionen. Der Erreger bleibt nach dem Toilettengang durch unzureichendes Händewaschen an den Händen haften und wird auf Türklinken, Handläufe oder andere Oberflächen übertragen. Dort kann er lange überleben.
Wie kann man sich davor schützen?
Heudorf: Die einfachste und sinnvollste Maßnahme ist gründliches Händewaschen. Es gibt diesen Spruch „Nach dem Klo und vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen“. Der ist nach wie vor gültig.
Der von Ihnen geleiteten EVA-Studie zufolge hatten Dreiviertel der niedergelassenen Ärzte in Hessen Fälle in ihrer Praxis, wo ein gängiges Antibiotikum versagt, ein Keim also resistent war. Zugleich werden 85 Prozent der jährlich in der Humanmedizin verordneten Antibiotika im ambulanten Bereich verbraucht. Verschreiben die Ärzte zu oft Antibiotika?
Heudorf: Laut der Studie gaben in unserem Bundesland im Jahr 2016 im Vergleich mit der bundesweiten Umfrage von 2008 sehr viel weniger Ärzte an, täglich eine Entscheidung über eine Antibiotika-Therapie zu treffen. Das Problembewusstsein ist also gestiegen.
Wogegen werden die meisten Antibiotika verschrieben?
Heudorf: Die befragten Ärzte nannten am häufigsten Harnwegserkrankungen, gefolgt von Atemwegserkrankungen und Ohrinfektionen. Zumindest bei den Atemwegserkrankungen ist bekannt, dass 80 Prozent der Fälle viral bedingt sind, Antibotika sind in dem Fall nutzlos. An sich müsste der Arzt diesen Patienten ohne Rezept aus der Praxis schicken. Das tun aber offenbar nicht immer alle.
Warum?
Heudorf: Danach haben wir sie in unserer Studie gefragt. Viele Ärzte wollen „auf der sicheren Seite“ stehen, befürchten eventuelle juristische Konsequenzen einer Nichtbehandlung oder haben das Gefühl, der Patient wünscht ein Antibiotikum. Umfragen der KV in Hessen haben aber gezeigt, dass zwei Prozent der Patienten den Arzt wechseln, weil er ihrer Meinung nach zu wenig Antibiotika verschreibt, doch acht Prozent wechseln, weil er zu viel Antibiotika verschreibt.
Wie kann der Arzt bei einer Atemwegserkrankung erkennen, ob hier eine bakterielle oder virale Infektion vorliegt?
Heudorf: Dafür gibt es Behandlungs-Leitlinien. Es gibt Scores, an denen die Ärzte sich orientieren können. Bei einem bestimmten Alter und bestimmten Symptomen sollte man ein Antibiotikum verordnen. Ansonsten kann der Arzt sagen: Wir beobachten das, wenn es nicht besser wird, kommen sie morgen wieder. Studien haben gezeigt, dass freitags mehr Antibiotika verschrieben werden, weil der Arzt den Patienten am Wochenende nicht sehen kann.
Es gibt aber Patienten, die ausdrücklich ein Antibiotika wünschen, weil sie keine Zeit für einen erneuten Praxisbesuch haben oder wieder arbeiten wollen.
Heudorf: Die Rate solcher „Wunsch“-Verschreibungen ist zwischen 2008 und 2016 deutlich zurückgegangen. In unseren „Weniger ist mehr“-Flyern erklären wir den Patienten: Wenn der Arzt Ihnen in bestimmten Fällen kein Rezept ausschreibt, tut er das bewusst und sehr verantwortungsvoll. Abgesehen von der Gefahr der Resistenzbildung haben Antibiotika auch Nebenwirkungen, sie schädigen die Darmflora und können zu Magen-Darm-Beschwerden führen.
Prof. Ursel Heudorf, Fachärztin für Pädiatrie und Öffentliches Gesundheitswesen, ist stellvertretende Leiterin des Amts für Gesundheit in Frankfurt am Main und Mitglied der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Berliner Robert Koch-Institut. Sie leitet das MRE-Netz Rhein-Main, in dem sich Ärzteverbände, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zusammengefunden haben, um multiresistenten Erregern entgegenzuwirken.
Foto: Stadt Frankfurt am Main