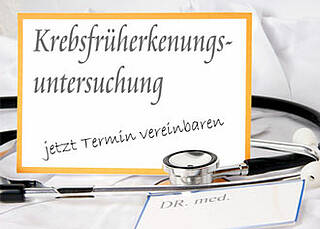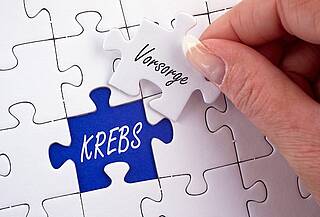Krebs mit „biomedizinischem Tattoo“ früh erkennen

So könnte das Krebsfrühwarnsystem aussehen: Ist der Kalziumpegel im Blut über längere Zeit zu hoch, erscheint ein Leberfleck auf der Haut
Krebserkrankungen würden wesentlich seltener tödlich verlaufen, wenn sie früher entdeckt würden. So sinkt zum Beispiel die Überlebenswahrscheinlichkeit bei fortgeschrittenem Prostatakrebs auf 32 Prozent, bei fortgeschrittenem Brustkrebs auf 25 Prozent und bei Darmkrebs auf 11 Prozent.
Eine effektivere Früherkennung verspricht nun eine Entwicklung der ETH-Zürich. Das Frühwarnsystem erkennt die vier häufigsten Krebsarten Prostata-, Lungen-, Dickdarm- und Brustkrebs schon dann, wenn lediglich die Kalziumwerte im Blut aufgrund des sich anbahnenden Tumors erhöht sind. Auf der Haut erscheint dann ein künstlicher Leberfleck. Die Forscher nennen es „biomedizinisches Tattoo“.
Implantat misst Kalziumspiegel
Das Frühwarnsystem besteht aus einem genetischen Netzwerk, das in Form eines Implantates in Köperzellen unter die Haut eingebaut wird. Dort überwacht ein Sensor permanent den Kalzium-Spiegel im Blut. Übersteigt dieser über längere Zeit einen bestimmten Schwellenwert, wird eine Signalkaskade in Gang gesetzt, die die Produktion des körpereigenen Bräunungsstoffs Melanin in den genetisch veränderten Zellen anregt. Äußerlich gut sichtbar formiert sich dann ein braunes Muttermal auf der Haut.
„Der Leberfleck erscheint lange bevor sich die entsprechende Krebserkrankung mit herkömmlichen Diagnosen feststellen lässt“, sagt Prof. Martin Fussenegger von der ETH-Zürich, sollte aber kein Grund zur Panik sein: «Der Leberfleck bedeutet ja nicht, dass die Person bald sterben muss, sondern lediglich, dass Abklärungen und allenfalls eine Behandlung nötig sind.“
Einsatz am Menschen dauert noch
Bisher wurde das Frühwarnsystem an Mäusen und Schweinen getestet. Dort hat es nach Angaben der Wissenschaftler zuverlässig funktioniert. Leberflecken entstanden demnach nur, wenn die Kalziumkonzentration tatsächlich über längere Zeit erhöht war. Bis zu einem Einsatz am Menschen werde es aber noch mindestens zehn Jahr dauern, berichtet Fussenegger. «Die Weiterentwicklung und vor allem klinische Versuche sind aufwändig und teuer, was wir als Forschungsgruppe nicht leisten können», sagt der ETH-Professor. Er wolle aber künftig die Translation seiner Entwicklungen fördern, damit diese eines Tages in anwendbare Produkte münden.
Im Fall einer Marktreife könnte das Implantat zu einer Selbstkontrolle dienen. Nachteil ist, dass die Lebensdauer solcher "verkapselter Lebendzellen" bislang auf ein Jahr begrenzt ist. Danach muss es inaktiviert und ersetzt werden.
Doch der Prototyp aus Zürich ist ja erst der Anfang. Und: Das Konzept lässt sich möglicherweise auch auf andere sich schleichend entwickelnde Krankheiten übertragen, schreiben die Forscher im Magazin «Science Translational Medicine», wo die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie soeben erschienen sind. Um beispielsweise neurodegenerative Erkrankungen oder Hormonstörungen aufzuspüren, würde der Sensor eben nicht Kalzium, sondern andere Biomarker messen. „Theoretisch ist das machbar“, so die Forscher.
Foto: ETH Zürich