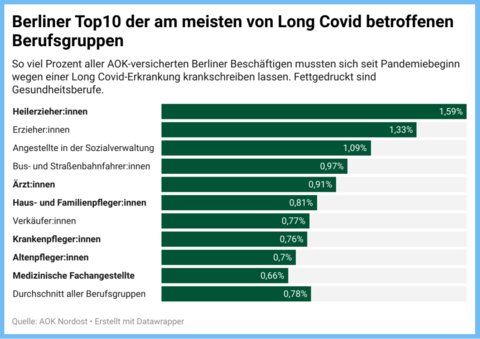„Können uns die Kosten für neue Krebsmedikamente leisten”

Hauptstadtkongress 2017: Heiße Debatte um die hohen Kosten für neue Krebstherapien
Die neuen Immuntherapien, zielgerichteten Medikamente und Antikörper gegen Krebs sind teuer. Bis zu 200.000 Euro im Jahr kann eine derartige Krebstherapie kosten. Ihr Nutzen ist dagegen manchmal fraglich. Nur wenige neue Medikamente schaffen einen Lebenszeitgewinn von einem Jahr oder mehr. Genau genommen sind es nur zwei unter den vielen Neulingen, die seit 2011 einer Nutzenbewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss unterzogen (G-BA) wurden: Cabozantinib und Afatinib. Die viel gepriesenen anderen Medikamente wie Pembrolizumab oder Nivolumab können zwar in Einzelfällen zu wundersamen Ergebnissen führen. In der Gesamtschau können sie das durchschnittliche Gesamtüberleben aber nur wenig mehr als sechs Monate verlängern.
Lebenszeitgewinn meist weniger als ein Jahr
Immerhin, sagen die einen. Zu wenig angesichts der hohen Kosten, sagen die anderen. Das war auch auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit am Mittwoch so, nachdem Dr. Florian Jantschak vom G-BA die ernüchternden Daten auf einer Folie präsentiert hatte. Schwarz auf weiß standen auf einmal die doch relativ kurzen Lebenszeitgewinne den exorbitanten Kosten gegenüber: im Schnitt 100.000 Euro pro Jahr und pro Patient. Dabei seien das nur die Daten aus den zulassungsrelevanten Studien, betonte Jantschak. In der Versorgungsrealität sähen die Lebenszeitgewinne wahrscheinlich noch viel schlechter aus. „Patienten mit Komorbiditäten und einem schlechten Allgemeinzustand werden in solche Studien gar nicht einbezogen“, so der Pharmakologe vom G-BA. Dass die neuen Krebsmittel dennoch oft einen Zusatznutzen bescheinigt bekommen, liegt oft weniger an der Überlebenszeit, sondern vielmehr an Kriterien wie Nebenwirkungen und Lebensqualität. Dafür zahlt die GKV dann einen stolzen Preis.
Chronifizierung von Krebs ist noch die Ausnahme
Schon lange wird darüber diskutiert, wie es in der Krebsmedizin mit den Kosten weiter gehen soll. Nicht selten wird dabei der Teufel an die Wand gemalt und der Zusammenbruch des deutschen Gesundheitssystems prophezeit. Pharmaunternehmen berufen sich bei solchen Diskussionen gerne auf ihre hohen Forschungs- und Entwicklungskosten von mehreren Hundert Millionen Euro pro Medikament. Oder sie verweisen auf den Fortschritt der letzten Jahrzehnte, so wie es Dr. Patrick Horber vom Pharmakonzern Abbvie Deutschland am Mittwoch in der Session „Chronifizierung von Krebs?“ tat. Die chronische Leukämie (CML) habe in den 1990er Jahren eine 5-Jahres-Überlebensrate von 30 Prozent gehabt. „Heute liegt sie bei über 90 Prozent“, betonte Horber.
Die CML ist das wohl eindrucksvollste Beispiel für die Chronifizierung von Krebs. Allerdings bislang auch fast das einzige. Dank neuer Medikamente bleiben CML-Patienten gesund, so lange sie ebendiese nehmen. Nur ganz wenige können die Krebsmittel absetzen, ohne wieder krank zu werden. Dafür bleiben die allermeisten so lange am Leben, wie sie es ohne ihren Blutkrebs geblieben wären. Ein toller Erfolg. Nüchtern betrachtet kostet das die Versicherungsgemeinschaft jedoch eine ganze Menge Geld. Aber darf man überhaupt so rechnen? In Deutschland ist das aus guten Gründen nicht erlaubt. Die ethisch moralische Frage, wieviel ein Menschenleben kosten darf, wird hierzulande (noch) nicht gestellt. Es gibt aber auch ein paar weniger emotional aufgeladene Argumente, die dafür sprechen, dass das deutsche Gesundheitssystem nicht an den Kosten für die Krebstherapie kollabieren wird.
Generika drücken Preise
Eines davon lautet: Die ersten Generika und Biosimilaris sind auf dem Markt und drücken die Preise. Die Kosten für den Wirkstoff Imatinib werden seit Dezember 2016 durch fünf neue Konkurrenten bereits um 80 Prozent gesenkt und die für Rituximab um 20 Prozent. Weitere Konkurrenzprodukte werden folgen und die Kosten senken. Ein Lichtblick.
Ein weiteres Argument nimmt Krebs als eine Krankheit unter vielen in den Blick und relativiert das Ganze. „Man muss das gesamte Ausgabenpaket sehen“, betonte Prof. Bertram Häussler vom IGES-Institut am Mittwoch in der Sitzung, und nicht den Kostenanstieg in einzelnen Bereichen. Bei den Herz-Kreislauferkrankungen etwa seien die Ausgaben stark gesunken. „Wenn Sie das zusammen addieren, sehen Sie, dass die Kosten im Gesundheitswesen gar nicht explodieren.“
Auch nicht in Zukunft, wo doch so viele neue Krebsmittel in der Pipeline sind?, mag man sich fragen. Und hier nannte Prof. Dirk Jäger vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) ein etwas vageres, aber durchaus überzeugendes Argument. Die Krebsmedizin werde immer präziser, sagte er. „Das führt zu großen Einsparpotenzialen.“ Der Krebsforscher meinte damit, dass die Patienten künftig passgenauer therapiert werden und viele unnütze Therapien wegfallen dürften. Heute sei es doch so, meinte Jäger, dass nicht einmal 20 Prozent der Patienten mit Darmkrebs ab Stadium III von den Chemotherapien profitierten, aber 100 Prozent der Patienten eine solche Therapie erhielten. Bei fortgeschrittenem Brustkrebs sei es noch schlimmer: Hier hätten weit unter 10 Prozent der Frauen einen Benefit von der aggressiven Chemotherapie.
Chronifizierung ist Heilung zweiter Klasse
Bleibt zu hoffen, dass Jäger Recht behält und statt der überflüssigen Maßnahmen bald Mittel für effektivere Therapien frei werden. Trotzdem bleibt bei vielen ein unguter Beigeschmack, wenn ein Krebsmedikament über 100.000 Euro im Jahr kostet. "Ich finde diesen Preis zu hoch und würde dafür wenigstens Heilung erwarten“, sagte Dr. Ulrike Holtkamp von der Patientenselbsthilfe Deutsche Leukämie und Lymphom-Hilfe, als es um die Debatte ging, ob Chronifizierung eines Krebsleidens gut oder schlecht sei. Ihrer Ansicht nach ist Heilung das Ziel und eine Chronifizierung – wegen der Nebenwirkungen der Therapie, Einschränkungen bei der Lebensqualität und der psychischen Belastung – letztlich nur die zweitbeste Lösung.
Dirk Jäger vom DKFZ sah das anders. Niemand könne Diabetes oder Bluthochdruck heilen, dennoch seien lebenslange Therapien hier gesellschaftlich akzeptiert. Bei der Krebstherapie würden hingegen ganz andere Kriterien angelegt und das findet der Krebsforscher ziemlich „ungerecht.“
Am Ende waren sich die Teilnehmer der Runde – einschließlich der beiden Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar und Georg Kippels - aber zumindest in der Kostenfrage einig: Deutschland könne die hohen Kosten für neue Krebstherapien wuppen, hieß es. CDU-Mann Kippels wörtlich: „Ich glaube, dass die Finanzierbarkeit gewährleistet ist.“