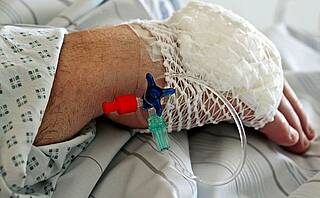Digitalisierung der Medizin: „Sonst tun das die Tech-Giganten“

„Es ist unverantwortlich Gesundheitsdaten nicht zu nutzen“, sagte Charité-Chef Heyo Kroemer (2. V. l.) auf dem Digitalforum Gesundheit am 20. Mai in Berlin
Vom Einkaufen übers Zeitungslesen bis hin zum Banking – praktisch das ganze Leben ist digitalisiert, nur das Gesundheitswesen ist es nicht. Dass es kein Weiter so geben darf, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Charité Prof. Heyo Kroemer auf dem Digitalforum Gesundheit am 20.Maimit deutlichen Worten. „Wir müssen die Digitalisierung noch in dieser Legislaturperiode schaffen, sonst drohen fatale Konsequenzen“, sagte er. Eile sei vor allem wegen der demografischen Entwicklung geboten, durch die dem Gesundheitswesen Jahr für Jahr tausende Arbeitskräfte verlorengingen. Laut Kroemer gibt es nur eine Möglichkeit, um den drohenden Kollaps abzuwenden: Das fehlende Personal durch digitale Lösungen zu ersetzen.
Doktor Google & Co stehen schon vor der Tür
Diese Lösungen aber sollten besser von innen heraus entwickelt werden, „sonst tun es die Tech-Giganten“, betonte Kroemer. Der Mediziner hält es für ziemlich realistisch, dass Player wie Google, Microsoft oder Amazon Care nicht nur Apps anbieten werden, wo Diagnosen ohne Arzt gestellt werden, sondern auch Kliniken übernehmen. „Die kommen nach Deutschland und werden auch Hardware aufkaufen, wenn wir jetzt nichts tun“, prophezeite der Charité-Chef.
Abgesehen von diesen Szenarien, die sich vermutlich niemand wünscht, verdeutlichte Kroemer den Stellenwert von Gesundheitsdaten für die individuelle Behandlung. Ein Beispiel gerade von einem Start-up der Charité entwickelt: Künstliche Intelligenz erkennt, wenn sich Vitalparameter von Patienten auf Intensivstationen verschlechtern viel besser als und schneller als jeder Intensivmediziner und ermöglicht so eine frühzeitige Intervention. Laut Kroemer sind im Samsung Krankenhaus in Seoul solche Anwendungen bereits seit zehn Jahren gang und gäbe. „Dort gibt es praktische keine Reanimationen mehr.“ Solche praktischen Beispiele zeigten, „dass es unverantwortlich ist, Gesundheitsdaten nicht zu nutzen.“
Pandemie hat den politischer Willen gestärkt, glaubt Kroemer
Hat die Politik den Warnschuss gehört? Kroemer glaubt, dass die Pandemie einiges ins Rollen gebracht habe, weil deutlich geworden sei, dass basale Informationen fehlten. „Ich habe den Eindruck, dass es jetzt den politischen Willen dazu gibt, das weiterzuentwickeln.“ Auch die Gesellschaft sieht er zur die Digitalisierung des Gesundheitswesens bereit.
Das fehlende Mind-Set galt neben dem strengen deutschen Datenschutz bisher als wesentlicher Hemmschuh, warum das teuerste Gesundheitssystem der Welt digital so rückständig ist. Die Nicht-Datennutzung hat aber auch technische Gründe. Die vielen Gesundheitsdaten, die in Kliniken gesammelt werden, liegen in Datensilos nebeneinander, sie sind nicht für den Austausch konzipiert. Erst recht nicht für den Austausch mit externen Daten. So nutzt die Apple-Watch am Handgelenk im Notfall gar nichts, weil die Klinken die Daten gar nicht „lesen“ können.
So kommen Kliniken aus der Datensilofalle
„Es gibt Lösungen dafür“, sagte Nils Hellrung, Vorstand der vitagroup München, nämlich durch den Aufbau „offener Plattformen.“ Drei Dinge seien bei einer solchen datenzentrierten Informationsarchitektur elementar: Erstens: Konsequente Trennung von Anwendung und Daten. Zweitens: Konsequente Standards für die Übertragung und Speicherung von Gesundheitsdaten. Drittens: Herstellerunabhängigkeit – durch entsprechende Einkaufsbedingungen.
„Speichern Sie Ihre Daten nach Standards, so dass Blutdruck auch immer Blutdruck bedeutet“, riet der Medizininformatiker. „Und machen Sie sich unabhängig vom Hersteller, damit Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben und handlungsfähig werden.“
Doch selbst wenn Kliniken eines Tages über offen Datenplattformen verfügten, wie sie Nils Hellrung nahelegte: Der Austausch von Gesundheitsdaten ist in Deutschland in einem halben Dutzend Gesetzen geregelt, darunter verschiedenen Landesgesetzen: So schreibt etwa das Berliner Krankenhausgesetz vor, dass Patientendaten nur innerhalb der Klinik genutzt werden können. Ähnliche Restriktionen gelten in Bayern.
Gesundheitsdatennutzungsgesetz noch eine Black Box
Nun kommt mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz bald ein weiteres Paragraphenwerk auf Bundesebene hinzu. Nach Auskunft der Frankfurter Rechtsanwältin Susanne Klein soll das neue Gesetz „Gesundheitsdaten zugängig machen - für Forschungszwecke und zum Wohle aller“, wie sie betonte. Allerdings gebe es noch keinen Gesetzesentwurf. „Das Gesetz ist im Moment noch eine Black Box“, sagte sie. Und dass das Gesundheitsdatennutzungsgesetz nun alle bisherigen Hürden aus dem Weg räumen könnte, glaubt sie nicht. Denn da ist noch Europa mit dem „Data Governence Act“, das etwa ein „Opt-in“ vorschreibt, also eine explizite Einwilligung der Patienten, damit Daten genutzt werden können. Es sei schwer durch nationale Regelung von den europäischen Vorgaben abzuweichen, erklärte Klein. Offen sei, wie Bundesebene damit umgehe. „Es bleibt spannend“, so die Datenschutzexpertin.