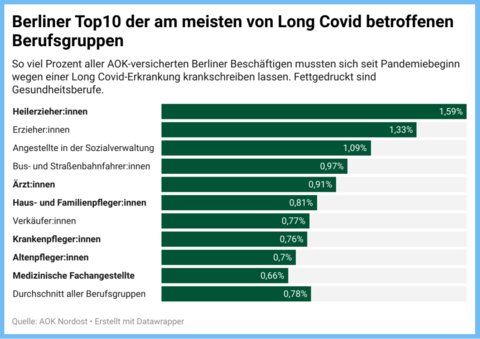Depression ist nicht gleich Depression

Studie: Trauer ist das größte Problem bei Depressionen – Foto: eyetronic - Fotolia
Daten von mehr als 3700 depressiven Patienten in der ambulanten Behandlung in den USA wertete der klinische Psychologe und Psychopathologe Dr. Eiko Fried von der Freien Universität Berlin gemeinsam mit dem US-amerikanischen Forscher Professor Randolph Nesse aus. Die Wissenschaftler analysierten, wie stark 14 verschiedene Depressionssymptome das psychosoziale Verhalten der Patienten beeinträchtigen.
Trauer macht die meisten Probleme
Dabei wiesen die Forscher nach, dass bestimmte Symptome einer Depression besonders stark mit sogenannten psychosozialen Beeinträchtigungen einhergehen. Das gilt zum Beispiel für Trauer und Konzentrationsschwierigkeiten. Diese beiden Symptome hatten auf alle Verhaltensfelder den stärksten negativen Einfluss. Die Forscher zeigten auch, dass andere Symptome besonders starke negative Effekte auf bestimmte psychosoziale Verhaltensfelder haben. So wirkt sich Interessensverlust in Bezug auf soziale Aktivitäten besonders stark negativ aus und Selbstvorwürfe beeinflussen vor allem das Verhalten in Beziehungen. Fried und Nesse gehen auf der Grundlage dieser Studienergebnisse davon aus, dass die Diagnose „Depression“ zu allgemein sein kann, um eine Behandlung zu gewährleisten, die effektiv ist und dem symptomatischen Zustand des Patienten entspricht.
Studienergebnisse gelten auch für Deutschland
Die Studie mit dem Titel "The Impact of Individual Depressive Symptoms on Impairment of Psychosocial Functioning" ("Die Auswirkung von individuellen depressiven Symptomen auf die Beeinträchtigung psychosozialen Verhaltens") und wurde in der Fachzeitschrift PLoS ONE veröffentlicht. „Unsere Studie basiert auf einer großen Anzahl depressiver Patienten aller Altersklassen und sozialen Schichten. Dies ist gerade bei klinischen Studien selten der Fall, da häufig nur stark vorausgewählte Personengruppen teilnehmen können“, sagt Fried. Ein weiterer Vorteil sei, dass die untersuchten Patienten bei Erhebung der Daten nicht unter dem Einfluss von Antidepressiva standen. „Die Ergebnisse sind daher auch auf Europa bzw. Deutschland übertragbar, da keine Unterschiede in der Medikamentenverfügbarkeit und -Einnahme bestanden haben“, so Fried weiter.
Depressionen
Depressionen gehören zu den bedeutendsten psychischen Erkrankungen. Weltweit leiden 16-20 Prozent der Menschen zumindest einmal im Leben an einer klinisch relevanten depressiven Störung. Frauen sind öfter betroffen als Männer. Das Robert Koch-Institut (RKI) misst Depressionen aufgrund ihrer Häufigkeit, Komplikationen und Folgen eine herausragende gesundheitspolitische und gesundheitsökonomische Bedeutung zu. Depressionen stehen in Ländern mit mittlerem oder hohem Einkommen an erster Stelle der Krankheitslast. Die Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aufgrund affektiver Störungen haben sich laut RKI zwischen 2000 und 2011 mehr als verdoppelt, mit einem etwas höheren Anstieg bei Frauen als bei Männern. Auch die Krankenkassen in Deutschland berichten in den letzten Jahren von einer deutlichen Zunahme von Krankschreibungen aufgrund psychischer und vor allem depressiver Störungen.
Foto: eyetronic - Fotolia.com