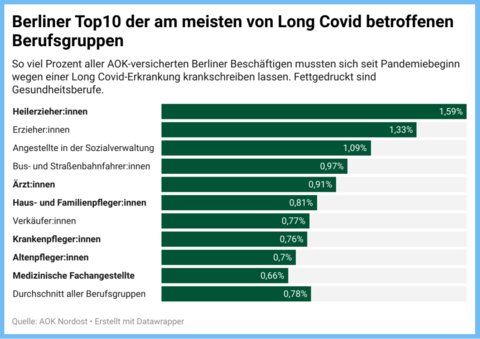Brustkrebs: Auch viele Jahre nach der Therapie leiden Patientinnen oft an Depressionen

Noch viele Jahre nach einer Brustkrebs-Therapie können Depressionen auftreten – Foto: ©Photographee.eu - stock.adobe.com
Selbst nach einer erfolgreichen Therapie sind viele Brustkrebs-Patientinnen noch über lange Zeit sehr belastet. Das haben Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in einer Studie belegt. Das zeigt, wie wichtig es ist, die psychische Verfassung bei der Behandlung betroffener Frauen nicht zu vernachlässigen, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.
Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Weltweit diagnostizieren Ärzte jedes Jahr mehr als zwei Millionen Neuerkrankungen; allein in Deutschland erhalten jährlich rund 69.000 Patientinnen diese Diagnose. Gleichzeitig verbessern sich aber auch die Überlebenschancen dank immer besserer Diagnostik und Therapie.
Fatigue und Muskel- und Gelenkschmerzen
Doch auch nach einer erfolgreichen Behandlung ist die Lebensqualität vieler Betroffener noch lange Zeit eingeschränkt. Sie leiden etwa unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom Fatigue oder unter therapiebedingten Muskel- und Gelenkschmerzen.
"Während das Auftreten von Depressionen innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Brustkrebstherapie bereits recht gut untersucht ist, ist über die Häufigkeit von Depressionen bei Langzeitüberlebenden bislang wenig bekannt", sagt Volker Arndt, Epidemiologe im DKFZ. "Wir wollten wissen, welche Rolle Depressionen bei Patientinnen auch noch viele Jahre nach der erfolgreichen Krebsbehandlung spielen, und welche Faktoren dies möglicherweise beeinflussen."
Brustkrebs: Depressionen oft noch viele Jahre nach der Therapie
Die DKFZ-Epidemiologen um Arndt untersuchten insgesamt 3.100 Brustkrebs-Überlebende, deren Therapie zwischen 5 und 16 Jahre zurücklag, auf Anzeichen einer Depression. Zum Vergleich schlossen sie 1.005 Frauen ohne eine entsprechende Krebserkrankung in ihre Studie ein. "Wir haben festgestellt, dass Langzeitüberlebende, deren Therapie bereits zwischen 5 und 15 Jahren zurückliegt, häufiger unter Depressionen leiden als Frauen, die nie an Brustkrebs erkrankt waren", sagt Erstautorin Daniela Doege.
Insbesondere betroffen waren Frauen, bei denen die Krebserkrankung wiedergekehrt war oder bei denen Metastasen festgestellt wurden. Weitere Risikofaktoren waren höheres Alter, Übergewicht, sowie eine eingeschränkte oder aufgegebene Berufstätigkeit. "Wie die einzelnen Faktoren das Depressionsrisiko beeinflussen, können wir auf der Grundlage unserer Studie allerdings nicht erklären", sagt Doege.
Auch psychische Verfassung im Blick behalten
Doch auch wenn sich die exakten Ursachen für das erhöhte Depressionsrisiko derzeit nicht ausmachen lassen, enthält das Studienergebnis eine bedeutende Botschaft: "Unsere Daten zeigen wie wichtig es ist, dass behandelnde Ärzte bei Brustkrebspatientinnen, gerade bei Betroffenen mit Metastasen oder wiederkehrenden Tumoren, nicht nur die rein onkologischen Symptome therapieren", sagt Arndt. "Entscheidend ist auch, die psychische Verfassung der Betroffenen im Blick zu behalten und bei Bedarf Hilfe anzubieten." Die Studie erschien im Fachmagazin Cancer Medicine.
Foto: Adobe Stock/Photographee.eu