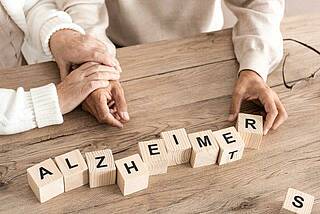Alzheimer: Tod von Gehirnzellen lässt sich schon früh im Blut nachweisen

Der Verlauf von Alzheimer zeichnet sich schon bis zu 16 Jahre vor Krankheitsausbruch im Blut ab
Obwohl schon Milliarden in die Alzheimer-Forschung geflossen sind, gibt es bis heute keine wirksame Therapie. Warum ist es so schwer, ein Gegenmittel gegen die weit verbreitete neurodegenerative Erkrankung zu finden, von der allein in Deutschland 700.000 Menschen betroffen sind?
Nach Ansicht von Neurowissenschaftler Mathias Jucker setzen die bisherigen Therapien viel zu spät ein – nämlich dann wenn die Alzheimer-Erkrankung schon fortgeschritten ist. Umso wichtiger sind verlässliche Methoden zur Frühdiagnostik, mit denen sich der Krankheitsverlauf verfolgen und vorhersagen lässt, bevor der Gedächtnisabbau beginnt. „Ein Bluttest eignet sich dazu viel besser, als beispielsweise teure Gehirnscans“, sagt Jucker, der am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Standort Tübingen, über Alzheimer und andere neurodegenerative Erkrankung forscht.
Abgestorbene Hirnzellen im Blut
Forscher um Jucker haben nun einen solchen Bluttest entwickelt. Anders als andere Bluttests aus der jüngsten Alzheimerforschung, werden damit nicht die Alzheimer typischen Eiweiße im Blut gemessen. „Unser Bluttest misst nicht das Amyloid, sondern das, was es im Gehirn anrichtet, nämlich Neurodegeneration. Anders gesagt: den Tod von Nervenzellen“, sagt Jucker.
Abgestorbene Hirnzellen hinterlassen zwar Überreste im Blut, sterben dort jedoch relativ schnell ab und sind daher kaum als Marker für eine neurodegenerative Erkrankung geeignet. Bloß ein kleines Stückchen eines sogenannten Neurofilaments widersetzt sich diesem Abbau und bleibt damit ein wichtiges Indiz.
Neurofilamente als Indiz für Alzheimer
Genau auf diesem Eiweißstoff basiert der neue Bluttest. „In der aktuellen Studie konnten wir zeigen, dass sich das Filament schon lange vor dem Auftreten klinischer Symptome – also bereits in der sogenannten präklinischen Phase – im Blut anreichert, dass es sehr empfindlich den Verlauf der Krankheit widerspiegelt und Vorhersagen über künftige Entwicklungen ermöglicht“, berichtet der Tübinger Neurowissenschaftler.
Die Studie basiert auf Daten und Proben von 405 Personen, die im Rahmen eines internationalen Forschungsverbunds – dem „Dominantly Inherited Alzheimer Network“ (DIAN) – erhoben wurden. Dieses Netzwerk untersucht Familien, bei denen aufgrund genetischer Veränderungen eine Alzheimer-Erkrankung schon im mittleren Alter auftritt. Genetische Analysen erlauben recht genaue Vorhersagen darüber, ob und wann ein Familienmitglied an Demenz erkranken wird.
16 Jahre vor den ersten Symptomen gibt es Auffälligkeiten im Blut
Über Jahre verfolgten die Forscher die Entwicklung der Filament- Konzentration bei den Probanden. Dabei machten sie eine erstaunliche Entdeckung: Bis zu 16 Jahre vor dem errechneten Eintreten von Demenzsymptome gab es im Blut auffällige Veränderungen. „Es ist nicht der absolute Wert der Filament-Konzentration, sondern deren zeitliche Entwicklung, die wirklich aussagekräftig ist und Vorhersagen über den weiteren Krankheitsverlauf erlaubt“, sagt Jucker.
Wie die Forscher weiter zeigen konnten, spiegelten die Veränderung der Neurofilament-Konzentration den neuronalen Abbau sehr exakt wider und erlaubten gute Prognosen darüber, wie sich das Gehirn in den nächsten Jahren entwickeln wird. „Wir konnten Vorhersagen über den Verlust von Hirnmasse und über kognitive Beeinträchtigungen machen, die dann zwei Jahre später tatsächlich eingetreten sind“, so Jucker.
Amyloid-Proteine nicht so aussagekräftig
Unterdessen war der Zusammenhang mit der Ablagerung toxischer Amyloid-Proteine weit weniger ausgeprägt. Laut Jucker stützt diese Beobachtung die Annahme, dass Amyloid-Proteine zwar ein Auslöser der Alzheimer-Erkrankung sind, der neuronale Abbau im weiteren Verlauf jedoch unabhängig erfolgt.
Da sich auch im Zuge weiterer neurodegenerativer Erkrankungen Blut Neurofilamente anreichern, eignet sich der Test nur bedingt zur Diagnose von Alzheimer. Aber der Test zeige sehr genau den Krankheitsverlauf an, meint Jucker, und sei damit ein ausgezeichnetes Werkzeug, um in klinischen Studien neue Alzheimer-Therapien zu erforschen.
Die Studienergebnisse wurden jetzt in der Zeitschrift „Nature Medicine“ veröffentlicht. Neben dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) war aus Deutschland auch das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung an der Studie mit dem Originaltitel „Serum neurofilament dynamics predicts neurodegeneration and clinical progression in presymptomatic Alzheimer’s Disease“ beteiligt.
Die Alzheimer-Krankheit ist eine hirnorganische Krankheit. Sie ist nach dem deutschen Neurologen Alois Alzheimer (1864 - 1915) benannt, der die Krankheit erstmals im Jahre 1906 wissenschaftlich beschrieben hat. Kennzeichnend für die Erkrankung ist der langsam fortschreitende Untergang von Nervenzellen und Nervenzellkontakten.
Foto: pololia/fotolia.com