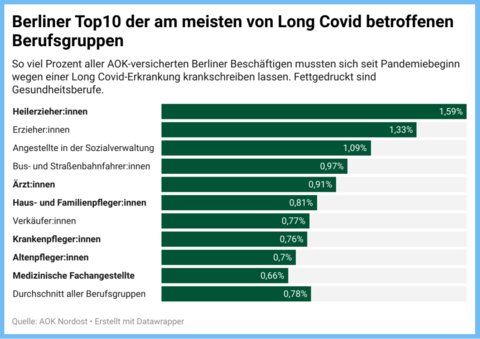Wie der Verlust des Partners auf das Gehirn wirkt

Der Verlust des Partners macht viele Menschen hilflos – Foto: Photographee.eu - Fotolia
Nach dem Verlust eines Partners bricht für viele Menschen eine Welt zusammen. Gefühle von Angst, Einsamkeit, Verzweiflung und Wut breiten sich aus, und bei einigen Betroffenen kommt es auf Dauer zu Antriebslosigkeit und Depression. Ein Grund dafür ist die vermehrte Aktivität des Stresshormons CRF, wie Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Tierphysiologie und Neurobiologie der Universität Regensburg gemeinsam mit Kollegen von der Emory University in Atlanta (USA) nun herausgefunden haben. Die Forscher wollten die physikalische Entsprechung zu Antriebslosigkeit und Depression nach einer Trennung in veränderten Gehirnvorgängen sichtbar machen. Dies gelang ihnen durch Studien an Präriewühlmäusen.
Verlust des Partners führt zur Blockade des Oxytocin-Systems
Präriewühlmäuse gehören zu den wenigen Säugetieren, die ein Leben lang in monogamer Gemeinschaft verbringen. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass die abrupte Trennung vom Weibchen bei den verlassenen Männchen das CRF-System im Gehirn aktiviert. CRF wiederum hemmt die Produktion und Ausschüttung von Oxytocin aus den Nervenzellen und verringert die Anzahl der Oxytocin-Bindungsstellen.
Oxytocin ist als sogenanntes „Kuschelhormon“ bekannt, stärkt soziale Bindungen und führt zu innerem Wohlbefinden und Entspannung. Indem das Stresshormon CRF dieses System fast völlig zum Erliegen bringt, werden die negativen Empfindungen des Trennungsschmerzes verursacht. „Wir können erstmals zeigen, dass der Verlust des Partners zur Unterdrückung des für die Partnerschaft so wichtigen Oxytocin-Systems führt, direkt verursacht durch die erhöhte Aktivität von CRF, das auch in depressiven Patienten eine Rolle spielt“, erklären die Studienautoren. Dem Forscherteam gelang es durch die gezielte Verabreichung von Oxytocin, die „depressiven“ und antriebslosen Männchen wieder zu aktivieren.
Trauer braucht Zeit
Nun kann man sich fragen, welchen Nutzen diese Erkenntnisse haben könnten. Sicherlich wird es nicht darum gehen, Trauer und Leid einfach durch Hormongaben „wegzutherapieren“. Doch die Erkenntnisse können Trauernden helfen, die eigenen Gefühle zu verstehen und einzuordnen. Wenn wir wissen, dass das Gehirn durch den Verlust auch chemisch aus den Fugen geraten ist, kann dies auch die Überzeugung stärken, dass sich der Stoffwechsel nach einiger Zeit wieder normalisiert und die Depression nachlässt. Die Studie zeigt auch, dass es wichtig ist, sich nach einem Verlust so viele gute Gefühle wie möglich zu verschaffen – auch wenn es manchmal völlig unpassend scheint. Aber nur so kann die Übertragung wichtiger Botenstoffe wieder aktiviert und den Stresshormonen entgegengewirkt werden.
Wichtig ist es in jedem Fall zu akzeptieren, dass Trauer Zeit braucht. Zwar sind manche Psychiater der Meinung, dass ein Trauernder bereits depressiv ist, wenn er sich mehr als zwei Wochen nach dem Verlust des Partners noch in einem extremen Stimmungstief befindet. Doch Trauer verläuft in mehreren Phasen, meist wellenartig, und lässt sich auch nicht beschleunigen.
Foto: © Photographee.eu - Fotolia.com